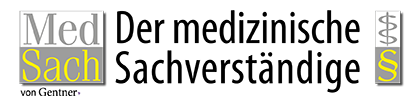Die medikamentöse Therapie der Adipositas ist zwar leitliniengerecht, wird aber in Deutschland selten eingesetzt. Sie ist nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erstattungsfähig, was in der Praxis eine große Hürde für Patienten und Behandler darstellt. Zusätzlich waren auch die mittleren Effekte bisheriger Medikamente zur Gewichtsreduktion nur moderat stärker als die der Verhaltenstherapie.
Mit Semaglutid 2,4 mg und Tirzepatid (bis 15 mg) stehen inzwischen aber medikamentöse Therapieoptionen für Menschen mit Adipositas zur Verfügung, die mehr als doppelt so effektiv in der Gewichtsreduktion sind wie bisher verfügbare Präparate.
Neue Daten zu Semaglutid und Tirzepatid geben berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass in Zukunft die Pharmakotherapie der Adipositas einen größeren Stellenwert im eskalierenden Therapiealgorithmus für Menschen mit Adipositas einnehmen kann. Diese Therapien haben durch Studien der letzten Jahre belegt, dass sie neben starken gewichtsreduzierenden Effekten auch Verbesserungen des Gesundheitszustandes und bei Komorbiditäten der Adipositas wie Fettlebererkrankungen, Schlafapnoe, Herzinsuffizienz und anderen bewirken.
Zukünftig könnte das Potential Inkretin-basierter Therapie noch um weitere duale Agonisten (z. B. Survodutide), orale Inkretinmimetika (Semaglutid, Orforglipron), oder Triple-Agonisten (z. B. Retatrutid), die zusätzlich zum GLP-1R, dem GIPR noch den Glukagon-Rezeptor aktivieren, erweitert werden. Dabei nutzen Inkretin-basierte Therapien offensichtlich gemeinsame, aber auch komplementäre Wirkmechanismen.
Zusätzlich könnten Kombinationstherapien wie zum Beispiel die Kombination von Semaglutid mit Cagrilintid die Effektstärke medikamentöser Adipositas-Therapien erweitern. Auch für den bei Gewichtsreduktion assoziierten Muskelmassen-Verlust gibt es eine pharmakologische Antwort für die Zukunft: In ersten humanen Studien konnte Bimagrumab beeindruckend die Fettmasse reduzieren bei gleichzeitigem Erhalt (oder sogar Aufbau) von Muskelmasse.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden