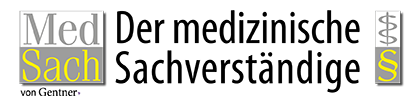Kai-Jochen Neuhaus: Berufsunfähigkeitsversicherung,
5. Auflage 2025, XLVI und 1.238 Seiten, gebunden,
Verlag C. H. Beck, München, 229,– Euro,
ISBN 978-3-406-80964-4
Das Werk „Berufsunfähigkeitsversicherung“ des Fachanwalts für Versicherungsrecht Kai-Jochen Neuhaus liegt jetzt in der völlig neu bearbeiteten 5. Auflage vor. Dabei war dem Autor, wie er im Vorwort erklärt, eine klare, verständliche Sprache ohne „juristisches Fachchinesisch“ besonders wichtig. Das komplexe Gebiet der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung sollte umfassend, praxisorientiert, kritisch und verständlich dargestellt werden. Das ist Neuhaus durchaus gelungen.
Im Folgenden soll nun allerdings nicht auf die umfassenden juristischen Ausführungen zu den verschiedenen Aspekten etwa vertragsrechtlicher Art eingegangen werden (für welche der Referent zudem nicht kompetent ist), sondern auf die für den medizinischen Sachverständigen besonders relevanten umfangreichen Kapitel „Medizinische Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit“ sowie „Medizinisches Sachverständigengutachten zur Berufsunfähigkeitsversicherung“.
Hier einige für den Sachverständigen wichtige grundsätzliche Ausführungen daraus:
Grundsätze der Beurteilung von Berufsunfähigkeit
Wer stellt den Grad der Berufsunfähigkeit im Gerichtsverfahren fest?
Die Feststellung des Grades der Unfähigkeit, den bisherigen Beruf weiter auszuüben, darf ... nicht dem Arzt allein überlassen werden, sondern erfordert eine schwierige Gesamtwürdigung, bei der die medizinischen Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen, aber bei weitem nicht allein maßgeblich sind. ... Es handelt es sich, auch wenn dies für viele Sachverständige schwer nachvollziehbar ist, nicht um eine medizinische, sondern um eine versicherungsvertragsrechtliche Frage, die abschließend durch das Gericht zu beurteilen ist.
Es ist nicht Aufgabe eines Sachverständigen, den Grad der Berufsunfähigkeit zu bestimmen. ... Daher ist die alltägliche Praxis, dass der außergerichtlich beauftragte Gutachter oder der Gerichtssachverständige einen Grad [der Berufsunfähigkeit] „auswirft“, falsch, denn ihm obliegt es nur zu ermitteln, was der Versicherte noch kann und was nicht ...
Keine Exploration beruflicher Aspekte durch den Gerichtssachverständigen!
In der (medizinischen) Literatur wird darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit vom Sachverständigen berufliche Aspekte, wenn erforderlich, nachexploriert werden sollen, weil die Exploration von Teiltätigkeiten ein bewährtes Element in der Arbeitsanalyse sei ...
Ein solches Vorgehen ist jedenfalls vor Gericht falsch, weil der BGH davon ausgeht, dass dem Sachverständigen ein unverrückbar feststehender Lebenssachverhalt vorzugeben ist. Daher dürfen auch Details nicht nachexploriert werden, zumal gerade diese oft das „Zünglein an der Waage“ des Grades der Berufsunfähigkeit sind und der Versicherte dadurch Gelegenheit erhält, zu dramatisieren, indem belastende Teiltätigkeiten geschildert werden, die womöglich nicht Gegenstand der vorher erforderlichen Beweisaufnahme zum Beruf waren. ...
Gutachter sollten genau prüfen, ob die Angaben des Versicherten deckungsgleich mit den vorgegebenen Tätigkeiten sind, etwaige Abweichungen im Gutachten kenntlich machen und ausführen, ob diese für das Ergebnis des Gutachtens relevant sind ...; ggf. hat der Sachverständige das Gericht um Klärung zu ersuchen.
Diese exemplarischen Zitate belegen die entscheidende Bedeutung juristischer Vorgaben für den medizinischen Sachverständigen, gerade bei Gerichtsverfahren. Neuhaus führt dazu weiter eine Fülle von Details an, etwa zu Leitlinien und v. a. zu den Besonderheiten von psychiatrischen Gutachten, deren Bewertung oft ein erhebliches Praxisproblem darstelle, so auch zur Plausibilitätsprüfung bzw. Beschwerdenvalidierung („Eine lege artis durchgeführte strukturierte Beschwerdenvalidierung kann die Qualität klinischer Bewertungen erheblich verbessern.“) Dabei schildert er sogar die Aussagekraft verschiedener testpsychologischer Verfahren.
Aus aktuellem Anlass geht Neuhaus auch auf Long-/Post-COVID und dessen Begutachtung ein. Da die entsprechenden von ihm zitierten Belege allerdings durchweg aus dem Jahr 2021 datieren, sind diese Begutachtungsempfehlungen inzwischen teilweise überholt (verwiesen sei hierzu etwa auf die einschlägigen aktuelleren Publikationen in dieser Zeitschrift).
Zusammenfassend ist jedoch festzustellen, dass gerade die genannten beiden Kapitel dieses umfassenden juristischen Fachbuches zur Berufsunfähigkeitsversicherung auch für den in diesem Gebiet tätigen medizinischen Sachverständigen von hohem Interesse sind – findet er doch eine so ausführliche, kompetente und weitgehend aktuelle Darstellung wohl nirgendwo sonst.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden