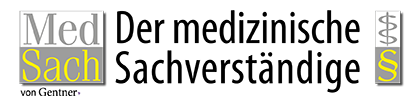Der Begriff der „Rentenneurose“ wird in der Medizin seit vielen Jahren als diskriminierend abgelehnt. Er findet sich jedoch in der ICD-10 unter F68.0 und ist in der Rechtsprechung weiter üblich.
Tatsächlich ist die zu Grunde liegende Rechtsprechung nahezu 100 Jahre alt, wie Klaus-Dieter Thomann, Leiter des IVM – Institut für Versicherungsmedizin, auf einem Seminar des IVM am 20. März 2025 in Frankfurt berichtete. Er zitierte ein Urteil des Reichsversicherungsamts vom 24.9.1926 mit weitreichenden Folgen:
„Hat die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten ihren Grund lediglich in seiner Vorstellung, krank zu sein, oder in mehr oder minder bewussten Wünschen, so ist ein vorangegangener Unfall auch dann nicht eine wesentliche Ursache der Erwerbsunfähigkeit, wenn der Versicherte sich aus Anlass des Unfalls in den Gedanken, krank zu sein, hineingelebt hat, oder wenn die sein Vorstellungsleben beherrschenden Wünsche auf eine Unfallentschädigung abzielen oder die schädigenden Vorstellungen durch ungünstige Einflüsse des Entschädigungsverfahrens verschärft worden sind.“
Was aktuell juristisch unter einer „Renten-“ oder „Begehrensneurose“ verstanden wird, erläuterte der Rechtsanwalt Stefan Möhlenkamp aus Hamm in der Fachzeitschrift „Versicherungsrecht“ (Heft 1/2025, S. 1–13) in einem Beitrag über die „Anforderungen an den gutachterlichen Nachweis psychischer Schäden im Haftungsprozess“:
Bei einer psychischen Vorbelastung des Geschädigten hat der sog. Schädiger (der Unfallverursacher) auch dann für eine psychische Fehlverarbeitung einzustehen, wenn eine hinreichende Gewissheit besteht, dass die psychisch bedingten Ausfälle ohne den Unfall nicht eingetreten wären. Er hat keinen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als habe er einen bis dahin Gesunden verletzt.
Ein solcher Anspruch entfällt allerdings bei einer (gutachtlich nachgewiesenen) Renten- oder (besser) Begehrensneurose des Geschädigten. In diesen Fällen steht das Motiv der Wiedergutmachung und Gerechtigkeit im Vordergrund oder – häufiger – nimmt der Geschädigte den Unfall in dem neurotischen Bestreben nach Versorgung und Sicherheit zum Anlass, den Schwierigkeiten oder Belastungen des Erwerbslebens auszuweichen.
Zur Bejahung einer Begehrensneurose im juristischen Sinn ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass die Beschwerden entscheidend/wesentlich durch eine neurotische Fehlhaltung geprägt sind, die der Schädiger nachweisen muss. Eine Begehrensneurose muss nicht sofort prägend sein, sondern kann sich auch erst im weiteren Verlauf einstellen.
Für die Beurteilung, ob eine Begehrenshaltung im Vordergrund steht, kommt es auf den Schweregrad des objektiven Unfallereignisses und seiner objektiven Folgen, auf das subjektive Erleben des Unfalls und seiner Folgen, auf die Persönlichkeit des Geschädigten sowie auf eventuell bestehende sekundäre Motive an. Zu bewerten sind die Gesamtumstände des Einzelfalls. Immer braucht es objektivierbare Anhaltspunkte, die nur im Rahmen eines Sachverständigengutachtens ermittelt werden können.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden