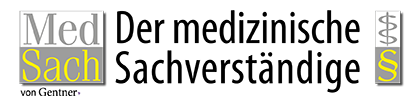Ohne einen funktionsfähigen Dialysezugang ist auch keine Hämodialyse möglich, das heißt, das Leben und auch die Überlebenszeit der Dialysepatienten hängen maßgeblich von deren Dialysezugang ab. Insgesamt werden die Patienten bei Beginn der Dialysebehandlung immer älter (medianes Alter: 71 Jahre) und weisen immer mehr Begleiterkrankungen auf, zum Beispiel koronare Herzkrankheit, periphere arterielle Verschlusskrankheit und/oder Diabetes mellitus. Damit werden auch die Anforderungen an die Schaffung und den Erhalt eines funktionstüchtigen Dialysezugangs immer höher.
Wie gut und wie lange ein solcher Shunt funktioniert, hängt wesentlich von der Expertise des ausführenden Zentrums ab. Häufige Komplikationen sind eine Stenose oder der Verschluss des Shunts, oder aber ein zu hoher Blutfluss, der das Herz belastet und zu einer Minderdurchblutung der Hand führt. Gefürchtete Komplikationen sind auch Infektionen, die bis zur Sepsis reichen können. Diese sind bei einem aus Eigengewebe geformten Shunt recht selten, bei künstlichen Prothesen-Shunts dagegen häufiger; bei diesen wird auch eine höhere Verschlussrate beobachtet.
Das höchste Infektionsrisiko besteht bei einem Dialysekatheter, der mit seiner Spitze im rechten Vorhof des Herzens platziert und durch die Haut nach außen geführt wird. „Ein Katheter gilt deshalb als letzte Option in der Dialyseversorgung, wenn die Anlage eines Shunts nicht möglich ist“, erläuterte Wilma Schierling, Leiterin Hochschulambulanz und Geschäftsführende Oberärztin der Abteilung für Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Regensburg.
Schon allein die Tatsache, von der Dialyse abhängig zu sein, belastet die Betroffenen körperlich und zeitlich erheblich. Jede Komplikation, allen voran der Shunt-Verschluss, bedeutet eine zusätzliche Belastung und geht oft mit einer notfallmäßigen stationären Behandlung einher. „Unser Ziel ist es daher, die Komplikationsrate so gering wie möglich zu halten“, betonte die DGG-Expertin Schierling.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden