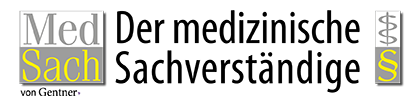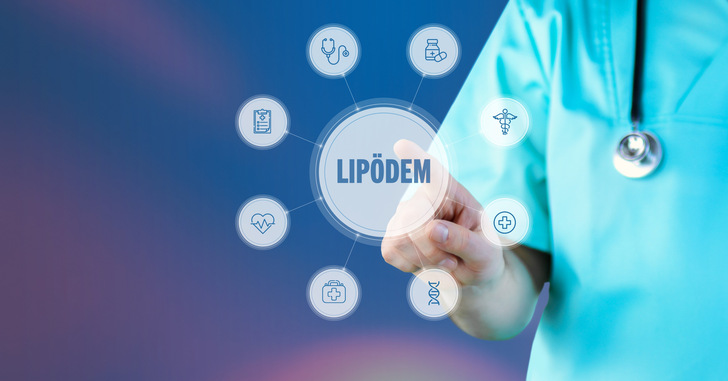Pathophysiologisch werden Östrogen-vermittelte Veränderungen der Adipozyten-Differenzierung, Lipogenese, Mikrozirkulationsstörungen und Kapillarfragilität als zentrale Faktoren diskutiert. Neben endokrinologischen Mechanismen sind psychosoziale und somatische Komorbiditäten entscheidende Determinanten des Krankheitsverlaufs.
Betroffene berichten über signifikante Einschränkungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, depressive Symptome und erhöhte Angst-Scores. Stigmatisierung, gesellschaftliche Schönheitsnormen und diagnostische Verzögerungen verstärken die psychosoziale Belastung und verdeutlichen die Notwendigkeit eines interdisziplinären, integrativen Versorgungskonzepts.
Die S2k-Leitlinie Lipödem der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie (DGP) von 2024 definiert erstmals einheitliche diagnostische Kriterien und evidenzbasierte Empfehlungen zur konservativen und operativen Therapie, insbesondere zu Indikationsstellung und Technik der Liposuktion. Internationale Studien bestätigen, dass die Liposuktion derzeit die einzige Methode zur dauerhaften Reduktion Lipödem-assoziierter Fettdepots darstellt, wobei allerdings die Evidenzlage limitiert bleibt, da randomisierte Langzeitstudien fehlen.
Trotz der gestiegenen Aufmerksamkeit bestehen weiterhin substanzielle Evidenzlücken. Bevölkerungsbasierte Prävalenzstudien fehlen bislang, und diagnostische Standards werden in der Praxis nicht flächendeckend umgesetzt. Auch zur Langzeitwirksamkeit konservativer und operativer Verfahren liegen nur begrenzt kontrollierte Daten vor. Psychosoziale Faktoren – insbesondere psychische Komorbiditäten, Körperbildstörungen und geschlechtsspezifische Stigmatisierung – sind in bestehenden Versorgungskonzepten bislang unterrepräsentiert, obwohl sie entscheidend zur Krankheitslast beitragen, kritisierte Eberle.
Gesundheitspolitisch bestehe die Notwendigkeit, verbindliche Qualitäts- und Indikationskriterien für alle Behandlungsformen zu etablieren. Eine nachhaltige Versorgungsstruktur erfordere ein langfristig finanziertes, interdisziplinäres Konzept, welches biologische, psychosoziale und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtige und einen gleichberechtigten Zugang zu evidenzbasierter, empathischer Betreuung sicherstelle.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden