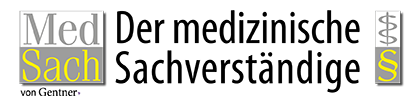In Deutschland ist jedoch aktuell sozialrechtlich noch die ICD-10 mit der Diagnose „Transsexualismus“ gültig. Das diagnostische Konzept des „Transsexualismus“ gilt unter Experten allerdings längst als obsolet.
Ausschlaggebend ist ein klinisch relevanter Leidensdruck, der zur Legitimation medizinischer Eingriffe in die Unversehrtheit des Körpers gegeben oder zumindest zu
erwarten sein muss. Der diagnostische Prozess wird detailliert in der S3-Leitlinie „Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: Diagnostik, Beratung, Behandlung“ (AWMF-Registernummer 138-001; derzeit in Überarbeitung) beschrieben und wird von psychotherapeutischer Seite aus durchgeführt.
Ziel dieser Diagnostik ist es nicht, die subjektive geschlechtliche Identifizierung der behandlungssuchenden Person in Frage zu stellen, sondern ein behandlungsbedürftiges Leiden festzustellen und einen gemeinsamen Prozess zu ermöglichen, in welchem die in Frage kommenden medizinischen Maßnahmen ermittelt werden, die zur Linderung des Leidens beitragen können.
Erforderliche Voraussetzungen für operative Maßnahmen zur Geschlechtsangleichung sind die von psychotherapeutischer Seite gestellte und gesicherte Diagnose einer Geschlechtsinkongruenz sowie die Bestätigung, dass der jeweilige Eingriff dazu geeignet ist, den Leidensdruck signifikant zu reduzieren. Dies soll nach der S3-Leitlinie 138/001 in einem kurzen Empfehlungsschreiben dargelegt werden, welches entweder von psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten erstellt werden kann.
Das bislang häufig praktizierte Vorgehen, die TSG-Gutachten zur Vornamens- und Personenstandsänderung (nach dem bis Mitte 2024 gültigen Transsexuellengesetz) zur Indikationsstellung für operative Maßnahmen zur Geschlechtsangleichung heranzuziehen, ist äußerst kritisch zu sehen, so die Autoren der aktuellen Leitlinie. Diese Gutachten haben in der Regel keinen Aussagewert hinsichtlich der Frage, ob ein medizinischer Eingriff erforderlich ist oder nicht; sie sind dem Rechtsgebiet des Personenstandsrechts und nicht dem des Sozialrechts zuzuordnen.
Die Anforderung eines zweiten Gutachtens aus psychotherapeutischer oder psychiatrischer Hand ist nicht notwendig und stellt in erster Linie eine Zugangsbarriere zur Versorgung dar, die nicht dem Wohl der Behandlungssuchenden dient. Auch der bisher geforderte „Alltagstest“ ist obsolet: Alltagerfahrungen sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung für operative Eingriffe.
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/043-052
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden