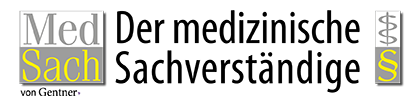In den vergangenen Jahren haben sich die Ausgaben für Psychotherapie deutlich erhöht, berichtete der PKV-Verband am 26. August 2025. Für WIP-Institutsleiter Frank Wild ist der Trend klar erkennbar: „Wir sehen bei den PKV-Ausgaben für ärztliche Leistungen in den Bereichen `Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie´ im Jahr 2023 eine Zunahme um 13,6 Prozent. Die Ausgaben liegen auch merklich über den Vor-Pandemie-Werten von 2019. Unsere Analysen liefern sehr gute Hinweise, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen zugenommen hat.“
Die Frage ist, was die Ursachen sind: Handelt es sich um Folgewirkungen der Corona-Pandemie, um Konsequenzen der Social-Media-Nutzung und der Informationsüberflutung, um eine Reaktion auf die zunehmenden Unsicherheiten hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung oder vielmehr um ein Resultat der abnehmenden Stigmatisierung, wodurch mehr Menschen Hilfe suchen und häufiger eine psychiatrische Diagnose erhalten? Vermutlich ist das Thema komplex, so Wild.
Tatsächlich belegen Daten, dass die Zahl psychischer Erkrankungen seit Jahren wächst. Laut Statista hat sich die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen seit 2000 mehr als verdoppelt – bei Frauen liegt sie konstant höher als bei Männern. Die Gründe sind vielfältig: Fachleute nennen die Pandemie mit ihren sozialen Einschränkungen, Zukunftsängsten und wirtschaftlichen Unsicherheiten als wesentlichen Faktor. Gleichzeitig ist die gesellschaftliche Offenheit gewachsen, über Depressionen, Angststörungen oder Burn-out zu sprechen. Diese Entstigmatisierung führt dazu, dass Diagnosen häufiger gestellt werden und Betroffene gezielter Hilfe in Anspruch nehmen.
Ein weiterer Aspekt ist das veränderte Medien-Nutzungs-Verhalten, vor allem unter Jugendlichen. Die aktuelle WHO-HBSC-Studie („Health Behaviour in School-aged Children“) erfasste zwischen 2021 und 2022 fast 280.000 Jugendliche in 44 Ländern Europas, Zentralasiens und in Kanada. Demnach ist der Anteil der 11- bis 15-Jährigen mit problematischer Social-Media-Nutzung von 7 Prozent im Jahr 2018 auf 11 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Laut WHO berichten diese Jugendlichen deutlich häufiger über geringeres seelisches und soziales Wohlbefinden, Schlafmangel, ein erhöhtes Risiko für Substanzmissbrauch und sinkende schulische Leistungen.
Eine Meta-Analyse in „Computers in Human Behavior“ (Coyne et al., 2021) unterstreicht zudem den Zusammenhang zwischen hoher Bildschirmzeit, psychischen Belastungen und einer verstärkten Neigung zu Angst- und Depressions-Symptomen.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden