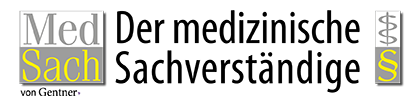Die medikamentöse Versorgung von Migränepatienten ist in Bewegung: Zwar sind und bleiben Triptane die Standard-Medikamente zur Behandlung akuter Migräneattacken. Gleichzeitig erweitern jedoch auch die neuen Wirkstoffe Lasmiditan und Rimegepant das Behandlungsspektrum. „Diese Substanzen bieten insbesondere Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen neue Optionen, da sie nicht gefäßverengend wirken“, erklärte Lars Neeb, Präsident der DMKG und Chefarzt der Neurologie am Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Für Lasmiditan konnte gezeigt werden, dass es auch bei Patienten, die auf Triptane nicht angesprochen haben, wirkt.
Auch in der Prophylaxe gibt es Fortschritte: Mit Atogepant und Rimegepant stehen seit kurzem orale CGRP-Rezeptorantagonisten zur Verfügung, die in Studien wirksam und gut verträglich sind. „Patienten profitieren von einer individualisierten Therapie, die Medikamente, digitale Tools und nichtmedikamentöse Verfahren kombiniert“, betonte Neeb.
Trotz dieser wissenschaftlichen Fortschritte und vielfältigen Therapieoptionen bleibt die Versorgung vieler Betroffener unzureichend. „Daten aus dem DMKG-Kopfschmerzregister zeigen, dass moderne, spezifische Migräneprophylaktika häufig erst spät im Krankheitsverlauf eingesetzt werden – oftmals nach Jahren unzureichender Behandlung“, so Neeb weiter. Ein frühzeitiger Zugang zu wirksamen Therapien sei jedoch wichtig, da er das Risiko einer Chronifizierung deutlich senken könne.
Neben Medikamenten gewinnen nicht-medikamentöse Verfahren zunehmend an Bedeutung. „Kognitive Verhaltenstherapie, Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen, Biofeedback sowie Ausdauer- und Kraftsport haben nachweislich positive Effekte und sollten fester Bestandteil jeder Migränebehandlung sein“, erläuterte Kongresspräsident Thomas Dresler von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Tübingen.
Zudem ermöglichen digitale Anwendungen, dass Betroffene entsprechend ihrer Symptome selbst aktiv werden können: „Mit der DMKG-App oder der SinCephalea-App können Patienten ihre Migräne gezielt beobachten und selbst Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen“, so Dresler.
Eine Migränebehandlung darf nicht auf die Gabe von Medikamenten beschränkt bleiben, betonten die Experten. Eine interdisziplinäre, multimodale Schmerztherapie (IMST), bei der Fachleute aus Schmerzmedizin, Psychologie, Physiotherapie und Pflege eng zusammenarbeiten, führe nachweislich zu besseren Ergebnissen und verhindert Chronifizierung.
„Eine erfolgreiche Schmerztherapie berücksichtigt immer körperliche, psychische und soziale Faktoren zugleich“, fasste Dresler zusammen. Ziel müsse es sein, Betroffene dazu zu befähigen, den Umgang mit ihrer Erkrankung aktiv mitzugestalten – mit einem klaren Ziel: weniger Kopfschmerztage, mehr Lebensqualität.
https://www.dgn.org/leitlinie/therapie-der-migraneattacke-und-prophylaxe-der-migrane
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden