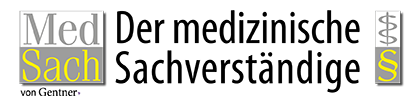Entscheidungstext
Die Berufung der Klägerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 20. März 2025 wird zurückgewiesen.
Außergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
Tatbestand
Die Klägerin begehrt nach Anerkennung der schädigenden Ereignisse noch die Gewährung von höherer und weiterer Beschädigtenversorgung nach dem Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten (OEG) i. V. m. dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) aufgrund von sexuellem Missbrauch im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren durch erwachsene Männer.
Sie ist 1985 als zweites von insgesamt fünf Kindern der Mutter, die alle von unterschiedlichen Vätern stammen, in H1 geboren. Die Schule hat sie regelmäßig bis zur fünften Klasse besucht, mit 14 Jahren ist zu von zu Hause ausgezogen und hat zunächst bei ihrem Freund, dann bei einer Freundin gewohnt. Die Geschwister sind nach Angaben der Klägerin vom Jugendamt aus der Familie genommen worden. Ausweislich der polizeilichen Aufstellung (vgl. Bl. 37 VerwAkte) ist die Klägerin wegen gemeinschaftlichen Raubes (1997), gemeinschaftlichen Ladendiebstahls (1997), gemeinschaftlicher Körperverletzung (1998), Körperverletzung (1998 und 2001), Sachbeschädigung/Nötigung (1999), Diebstahl (1999 und 2000), Bedrohung (2001) und Kokainhandels (2005) polizeilich in Erscheinung getreten, zu einem gerichtlichen Verfahren kam es nach ihren Angaben nicht. Sie ist mehrfach umgezogen. Seit ihrem 18. Lebensjahr war sie, wie ihre Mutter, als Prostituierte tätig und hat im Rahmen einer Aussteigerprogramms eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten abgeschlossen. Seit 2014 führte sie einer feste Beziehung, hat 2017 geheiratet, die gemeinsame Tochter ist 2018 geboren worden. Zwischenzeitlich ist die Ehe wieder geschieden und die Klägerin alleinerziehend. Nach ihren letzten Angaben ist sie wieder berufstätig (vgl. zuletzt Anamnese G1).
Am 7. Mai 2015 beantragte sie bei der seinerzeit zuständigen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration – Versorgungsamt H1 (nachfolgend einheitlich: Beklagter) die Gewährung von Beschädigtenversorgung. Geltend gemacht wurde, dass sie von ihrem 6. bis zu ihrem 14. Lebensjahr sexuell missbraucht worden sei. Ihre Mutter, eine Prostituierte, habe sie verschiedenen Männern zugeführt. Die weiteren Täter sollten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht benannt werden, seien aber der Polizei bekannt.
Der Beklagte zog die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft H1 (StA – Az.: 7204 Js 146/14) bei. Aus dem vorläufigen Schlussvermerk ergab sich – zusammenfassend, dass die Mutter der Klägerin S1 G2 (G) im Verdacht stehe, den sexuellen Missbrauch von Kindern gefördert zu haben, indem sie ihre leiblichen Kinder, die Klägerin und deren 1989 geborenen Bruder P1 G2 (PG), mehrfach zu Männern im Bekanntenkreis gegeben habe, damit diese sexuelle Handlungen an den Kindern hätten vornehmen können. Die G habe dafür Bargeld von den Männern erhalten. G sei manchmal bei diesen Treffen anwesend gewesen und habe ihren Kindern sexuelle Handlungen vorgemacht, die diese hätten nachmachen sollen. Die Kinder hätten hierfür Bargeld oder Kinderspielzeug erhalten. Nach Angaben der Klägerin hätten die Vorfälle zwischen 1991 und 1998 an verschiedenen Tatorten stattgefunden, PG habe lediglich einen Vorfall im Jahr 1997 konkretisieren können.
Der Beschuldigte K1 F1 (KF – verstorben 2016) habe die Klägerin dazu aufgefordert, Reizwäsche anzuziehen und habe sie dann sexuell motiviert angefasst. Weiter habe er zwischen 1994 und 1998 beischlafähnliche Handlungen mit der Klägerin vorgenommen.
Weiter bestehe der Verdacht, dass ein unbekannter Täter, benannt als „H2“, von der Klägerin sexuelle Handlungen an seiner Person habe durchführen lassen und selbst vorgenommen habe. Ein entsprechender Verdacht bestehe auch gegen die unbekannten Täter „J1 K2“ und „R1“.
Die Klägerin sei insgesamt dreimal zeugenschaftlich vernommen worden, sie habe die genannten Sachverhalte geschildert und ausführlich über ihre damalige und jetzige Lebenssituation berichtet. Sie habe den Verdacht, dass nicht nur PG, mit dem sie sich darüber unterhalten habe, sondern auch ihren weiteren Geschwistern M1 G2 und S2 G2 ähnliches widerfahren sei. M1 G2 habe keine Angaben machen wollen, da er psychisch krank sei. S2 G2 habe sich an keine derartigen Vorfälle erinnern können, sei zudem sehr früh aus der Familie genommen worden.
Die Klägerin habe zwei Tagebücher übergeben, in denen sie über das problembehaftete Verhältnis zu ihrer Mutter, ihren eigenen Drogenkonsum und zum Teil von den beschriebenen Sachverhalten berichte. Bei der Jugendhilfe seien mehrere Bände Akten zur Familie der Klägerin vorhanden.
Mit Beschlüssen des Amtsgerichts H1 (AG – Az.: 162 Gs 1084/14) vom 10. November 2014 wurde die Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume des KF und der G angeordnet. Der KF gab während der Durchsuchung an, dass er damals in seiner Pension in der E1 einen „Puff“ betrieben habe. Die G habe mit ihren Kindern und ihrem Ehemann dort eine Zeit lang gewohnt, G habe häufiger „Kunden dabei“ gehabt. Er könne sich an vieles nicht mehr erinnern, da es zu lange her sei.
Mit weiterem Beschluss des AG vom 30. Juni 2015 wurde die Übermittlung der Akten des Jugendamtes an die Staatsanwaltschaft angeordnet.
In der Hauptverhandlung beim AG gegen G am 19. Mai 2016 gab diese an, dass sie zu dieser Zeit als Prostituierte gearbeitet habe. KF habe sie auf die Klägerin angesprochen und habe diese „mit dem Finger berührt“. Er habe das dann immer wieder gewollt und sie – G – damit erpresst, dass sie die Wohnung verliere und er mit der Klägerin abhaue. Die Klägerin sei so 10 Jahre alt gewesen, KF habe die Klägerin angefasst. Sie sei mit im Raum gewesen. Von einem Vibrator oder einer Kerze habe sie nichts bekommen, auch nicht davon, dass KF die Klägerin gefesselt hätte. Man habe gesehen, dass die Klägerin „das nicht so witzig fand“, das sehe man bei einem Kind ja auch am Verhalten. Geweint habe die Klägerin nicht, sich aber schon ein bisschen gewehrt. KF sei zu diesem Zeitpunkt ihr Vermieter gewesen. Sie habe von ihm meist 50 bis 100 DM bekommen, H2 und Herr C1 hätten meist so 100 DM gezahlt. Die Klägerin habe sie circa vier Mal zu dem KF mitgebracht. Die Klägerin habe ihr hinterher gesagt, dass sie das nicht gut finde, sei aber immer wieder mitgekommen. Die Familie habe ja auch in Geldschwierigkeiten gesteckt. Sie – G – habe der Klägerin gesagt, dass sie nichts zu essen hätten, wenn die Klägerin nicht mitkomme.
Auf Nachfrage: Es könne sein, dass die Klägerin seit ihrem 14. Lebensjahr nicht mehr bei ihr gewohnt habe. Es habe einen Vorfall gegeben, da sei die Klägerin ausfallend und frech geworden, sodass sie sie rausgeschmissen habe. „H2“ sei mehr so auf Jungs gewesen, die Klägerin habe sich nicht mit „H2“ getroffen, nur mit KF und C1. Zu „H2“ habe sie nur PG mitgenommen. Die anderen beiden Kinder habe sie nie mitgenommen, warum, wisse sie nicht.
Mit Urteil vom 10. Juni 2016 (rechtskräftig seit 5. Dezember 2017) verurteilte das AG die G wegen Beihilfe zur schweren sexuellen Nötigung sowie Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren.
Der Beklagte zog das Vorerkrankungsverzeichnis der Krankenkasse (AOK – vgl. Bl. 475 VerwAkte) bei und holte Befundscheine der behandelnden Ärzte ein:
Der K3 gab eine Behandlung der Klägerin vom 22. August 2001 bis 4. Juni 2009 an. Es hätten keine Funktionsstörungen körperlicher Art bestanden, aber eine deutliche Angststörung und ein Zustand nach bekannter Polytoxikomanie.
Das A1 Klinikum H1 Nord teilte mit, dass keine Behandlungsunterlagen aus 2002 ausfindig zu machen gewesen seien.
Die B1 beschrieb fünf Behandlungen der Klägerin in 2009. Diese habe angegeben, mit 14 Jahren von der Mutter rausgeworfen worden zu sein. Danach habe ein Drogenabusus bestanden. Die Geschwister seien ins Heim bzw. in Pflegefamilien gekommen. Die Klägerin sei von der Mutter an „Freier“ verkauft worden, der Vater habe alles zugelassen. Mit 16 Jahren habe sie einen Suizidversuch mit Tabletten unternommen. Es bestünden Konzentrationsstörungen und eine stark beeinträchtigte Beziehungsfähigkeit. Als Diagnose wurde eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) angegeben.
Im Bericht des Klinikums F2 H3 (ambulante Untersuchung vom 22. November 2016, stationäre Behandlung bis 25. November 2016) wurden eine Ischialgie und eine passagere Hemiparese rechts, am ehesten psychogen, beschrieben. Die Computertomographie (CT) des Schädels habe einen regelrechten Befund ergeben. Ebenso seien die Kernspintomographien (MRT) des Gehirnschädels und der LWS ohne Befund gewesen. Bereits bei Aufnahme habe sich ein unauffälliger neurologischer Befund bei dissoziativer Hemiparese rechts ergeben. In der Verlaufsuntersuchung sei die Hemiparese nicht mehr nachweisbar gewesen. Ein Bandscheibenvorfall sei ausgeschlossen worden, unter Physiotherapie und analgetischer Therapie habe sich der Befund im Verlauf gebessert. Bezüglich der Migräne werde als Prophylaxe zu leichtem Ausdauersport geraten.
C2 teilte eine Behandlung im Februar 2017 wegen einer depressiven Verstimmung mit.
Im Entlassungsbericht des Z1-Klinikum W1 (stationäre Behandlung vom 20. April bis 20. Juni 2017) wurde ausgeführt, dass die Klägerin vor zwei Jahren Strafanzeige bezüglich sexuellen Missbrauchs in der Kindheit gestellt habe. Seitdem gehe es ihr schlechter. Die Kindheit sei sehr belastend gewesen. Vom 7. bis zum 14. Lebensjahr sei sie sexuell missbraucht worden. Die Mutter habe als Prostituierte gearbeitet und sie – die Klägerin – auch den Kunden zur Verfügung gestellt. Mit 14 Jahren sei sie von der Mutter vor die Tür gesetzt worden. Das Verfahren gegen die Mutter sei sehr belastend gewesen, ein Berufungsverfahren stehe noch aus.
Die Klägerin habe angenommen, die Erlebnisse gut verarbeitet zu haben, habe die Chance einer Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin genutzt und sich darauf wie auf die Verhandlung fokussiert. Nachdem etwas Ruhe eingekehrt sei, sei eine sehr stark belastende psychische Symptomatik aufgetreten. Sie leide unter intrusiven Erinnerungen und massiven Schlafstörungen. Wenn sie schlafe, seien Alpträume vorhanden. Sie befinde sich immer in Hab-Acht-Stellung, sei schreckhaft und dauerhaft angespannt. Darunter hätten sich auch körperliche Beschwerden in Form von Schmerzen eingestellt. Es hätten sich Phasen entwickelt, in denen eine massive Erschöpfung und Antriebslosigkeit mit Anhedonie vorhanden sei und sie die Tage ausschließlich im Bett verbringe.
Die Klägerin sei kürzlich zu ihrem Partner nach N1 gezogen, habe angenommen, dass die depressive Symptomatik durch die neue Umgebung verschwinden werde. Sie fühle sich in der Wohnung des Freundes unwohl, habe die Tendenz, exzessiv zu putzen oder aufzuräumen. Eine Zeit lang habe sie die Türgriffe in der Küche täglich reinigen müssen. Seit 2017 bestehe eine Anbindung an die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA).
Am Alter von 14/15 Jahren habe sie Kokain, Ectasy, Amphetamine und Cannabis eingenommen, sei dann jedoch aus H1 weggezogen, um sich von den Drogen zu lösen. Alkohol trinke sie aktuell sehr selten, nicht exzessiv. Selten konsumiere sie noch Cannabis, zuletzt im Januar 2017.
Die Klägerin sei mit vier Geschwistern aufgewachsen, nur ein Bruder stamme vom Ehemann der G., alle anderen Kinder aus sexuellen Beziehungen der G mit ihren Kunden. Die Familienverhältnisse seien chaotisch, unhygienisch und verwahrlost gewesen, das Jugendamt sei ein- und ausgegangen. Irgendwann seien alle Kinder aus der Familie genommen worden, sie selbst sei da schon ausgezogen gewesen.
Bei Aufnahme sei die Klägerin wach und bewusstseinsklar, im Kontakt freundlich zugewandt, leidend und gequält gewesen. Die Orientierung zu Person, Ort, Zeit und Situation sei regelrecht. Auffassungsgabe und Merkfähigkeit schienen ungestört, die Konzentrationsfähigkeit sei subjektiv als vermindert angegeben worden. Das formale Denken sei geordnet, sprunghaft und beschleunigt. Eine ausgeprägte Grübelneigung habe bestanden, die Stimmung werde als phasenweise massiv gedrückt beschrieben. Psychomotorisch werde ein Wechsel aus Rückzug und ausgeprägter Ablenkung beschrieben. Eine posttraumatische Symptomatik habe in Form von Intrusionen und nächtlichen Alpträumen imponiert.
Anlass der Aufnahme sei das komplexe Störungsbild aus einer schwer depressiven Symptomatik, gepaart mit intrusiven Phänomenen und Alpträumen vor dem Hintergrund einer PTBS, hohen Leistungsansprüchen an die eigene Person und der starken Tendenz zur Selbstabwertung gewesen. Ambulante Maßnahmen wie zuletzt durch Anbindung an die PIA seien nicht mehr ausreichend, die Belastbarkeit nur noch eingeschränkt vorhanden.
Unter dem therapeutischen Regime sei es zu einer Besserung von Stimmung und Antrieb gekommen. Die Klägerin habe körperlich belastbarer gewirkt und habe weniger über muskuläre Verspannungen geklagt. Sie habe eine Begeisterung für angenehme Aktivitäten wie Sport entdeckt. Hierbei habe eine Neigung zur Überforderung imponiert, der Umfang der sportlichen Betätigung habe immer wieder kritisch angesprochen werden müssen.
Eine besondere Belastung sei in der letzten Behandlungswoche die durch den Rechtsanwalt verkündete Information gewesen, dass die Klägerin im September 2017 im Berufungsverfahren erneut vor Gericht erscheinen müsse und ein Gutachter bestellt sei, da die grundsätzliche Schuldfähigkeit der G in Frage gestellt werde.
Im Rahmen der stationären Therapie sei es zu einer sehr guten Stabilisierung und deutlichen Befundbesserung gekommen. Die Entlassung sei am 20. Juni 2017 ins häusliche Umfeld erfolgt. Eine ambulante psychotherapeutische Weiterbehandlung werde unbedingt empfohlen.
Im Bericht des Z1 Klinikum W1 über die ambulanten Behandlungen vom 7. März 2017, 28. Februar 2018 und 28. März 2018 wurde ausgeführt, dass bei der letzten Vorstellung Ärger als Gefühl im Vordergrund gestanden habe. Der Bruder der Klägerin habe ein Telefonat der G angenommen, die darum gebeten habe, ihr Gnadengesuch zu unterstützen. G habe geweint, weil sie in Haft müsse. Die Klägerin denke, dass es angemessener sei, wenn G traurig über das sei, was sie ihren Kindern angetan habe. Es sei eine erneute Vorstellung in der Psychosomatik nach der Geburt des Kindes und je nach weiterem Verlauf eine erneute stationäre Traumabehandlung zu empfehlen.
Der Beklagte holte das psychiatrische Gutachten des L1 aufgrund ambulanter Untersuchung vom 28. Mai 2019 ein. Diesem gegenüber gab die Klägerin an, dass G eine hypochondrische Struktur und häufig unter Depressionen gelitten habe. Diese habe als Prostituierte gearbeitet und sei derzeit inhaftiert. Ihr leiblicher Vater sei ihr nicht bekannt.
Die Klägerin habe den Kindergarten besucht und sei mit sechs Jahren eingeschult worden. Ab dem 6. Schuljahr sei sie nur noch gelegentlich in die Schule gegangen. Sie sei dann immer wieder anderen Schulen zugewiesen worden, die sie jedoch nicht besucht habe. Ein letztes Schulzeugnis habe sie nach dem 6. Schuljahr ohne Bewertung erhalten.
Da G depressiv gewesen sei und oft nicht habe aufstehen können, habe die Klägerin die Geschwister versorgt. Ansonsten habe sie sich mit einem Freund auf der Straße aufgehalten. Von 2001 bis 2003 sei sie formal im Berufsvorbereitungsjahr gewesen, habe mit dem Drogenkonsum begonnen, die Schule nur sporadisch besucht und die Schulen gewechselt. Die Berufsvorbereitung habe sie ohne Abschluss beendet. Etwa vom 19. bis zum 21. Lebensjahr habe sie mit einem Freund zunächst ein Internetcafe und nachfolgend ein Restaurant geführt. In den folgenden Jahren, bis etwa zum 30. Lebensjahr, habe sie überwiegend als Prostituierte in H1, H4, I1 und N2 gearbeitet. Schließlich sei sie im Rahmen eines Aussteigerprogramms über sechs Monate als Praktikantin in einer Anwaltskanzlei tätig gewesen und habe vom 1. September 2014 bis 18. Januar 2017 erfolgreich eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten absolviert. In der Ausbildung habe sie zahlreiche Grundlagen nacharbeiten müssen. Insgesamt sei ihr die Zeit sehr schwergefallen. Nach erfolgreicher Ausbildung sei sie in eine Festanstellung übernommen worden. Bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Depression sei zum 31. März 2017 die Kündigung erfolgt. Am 5. März 2018 sei ihre Tochter geboren worden, derzeit befinde sich die Klägerin in Elternzeit.
Vom 13. bis zum 18. Lebensjahr habe die Klägerin erste partnerschaftliche Beziehungen unterhalten. Mit 14 Jahren sei sie zu Hause rausgeschmissen worden und habe bei ihrem Freund gelebt. Die nachfolgende Beziehung über anderthalb Jahre habe sich aufgrund einer schizophrenen Erkrankung des Partners konfliktreich gestaltet. Sie habe nachfolgend wechselnde Partner gehabt. Seit dem 22. Lebensjahr sei sie über fünf Jahre mit einem Freund zusammen gewesen, der zahlreiche Drogen konsumiert habe. Sie habe daher H1 und den Freund verlassen. Seit 2014 lebe sie in Partnerschaft mit ihrem derzeitigen Ehemann, der als Wirtschaftsinformatiker tätig sei. Am 1. Juli 2017 habe sie geheiratet.
Zur Familiengeschichte habe die Klägerin dargelegt, dass sie G als einen sehr dominanten, immer lauten und andauernd kranken Menschen erlebt habe. Gemeinsame Freizeitaktivitäten habe es in der Familie nicht gegeben. Der Stiefvater habe im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten versucht, für die Kinder da zu sein. Die Familie habe in ständigem Kontakt mit dem Jugendamt gestanden.
Die vorliegenden Angaben zum sexuellen Missbrauch seien zutreffend. Aufgrund der ausgeprägten emotionalen Reaktionen der Klägerin sei auf konkrete Angaben zum erfahrenen sexuellen Missbrauch verzichtet worden. Die Klägerin gebe an, dass über den sexuellen Missbrauch und die beschriebenen Erlebnisse und Erfahrungen hinaus keine außergewöhnlich belastenden Lebensereignisse aufgetreten seien.
Zu psychischen Gesundheitsstörungen habe die Klägerin angegeben, dass sie unter Ein- und Durchschlafstörungen leide. Albträume kenne sie bereits seit ihrer Kindheit. Sie träume, dass sie ihrem Bruder nicht helfen könne. Häufig fühle sie sich innerlich so unruhig und getrieben, dass es ihr schwerfalle ins Bett zu gehen. Schlafe sie schließlich ein, erwache sie häufig nach einer Stunde. Am folgenden Tag sei sie manchmal so müde, dass sie nicht aufstehen könne. In Bezug auf die Schlafstörungen sei nach der Strafanzeige gegen die Mutter 2014 eine Zunahme eingetreten. Nach der stationären Krankenhausbehandlung 2017 sei es zu einer vorübergehenden Besserung gekommen, nachfolgend zu einer erneuten Zunahme.
Seit ihrer Kindheit leide sie unter einem Putzzwang. Dieser sei häufig so ausgeprägt, dass es ihr nicht möglich sei, spontane Besuche zu empfangen. Dieses Verhalten belaste auch ihre Beziehung. Sie sei häufig aufbrausend und reizbar, in ihrer Jugend habe sie oft aggressiv reagiert, beispielsweise die Wohnung zerstört. Seit der Kindheit bestehende migräneartige Kopfschmerzen träten etwa drei- bis viermal pro Woche auf. Seit der Strafanzeige gegen die Mutter komme es immer wieder zu kurz andauernden, wechselnden körperlichen Beschwerden, u.a. im Bereich der Kniegelenke und der Lendenwirbelsäule.
Im Verlauf der Ausbildung sei ihr aufgefallen, dass sie sich nur schlecht konzentrieren könne und ihr Gedächtnis schlecht sei. Andauernd bestehe ein Gefühl der inneren Leere. Seit der Jugend sei die Stimmungslage sehr instabil, immer wieder komme es zu lebensmüden Gedanken. Im Alter von 16 Jahren habe sie einen Suizidversuch mit Tabletten unternommen. Seit der Gerichtsverhandlung gegen die Mutter komme es wieder häufiger zu einer gedrückten Stimmungslage. Ständig sorge sie sich um ihre Tochter, befürchte, dem Kind nicht gerecht zu werden. Andauernd leide sie unter Erinnerungen an den erfahrenen Missbrauch. Derzeit würden diese Erinnerungen an etwa fünf Tagen in der Woche, häufig vor dem Einschlafen, lebendig. Immer wieder müsse sie über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in der Kindheit grübeln. Sie könne nicht verstehen, warum ihr dies passiert sei.
Eine erste psychotherapeutische Behandlung seit circa 2010 in N2 aufgrund einer depressiven Symptomatik erfolgt. Sie habe die Therapie abgebrochen, da sie nicht fähig gewesen sei, sich ausreichend zu öffnen. Ab Ende 2016 sei es zu einer erneuten Zunahme der Beeinträchtigungen und dem Verlust der Lebensfreude gekommen. Im Februar 2017 habe sie eine Einweisung in die psychiatrische Klinik erhalten, sei aber nicht in die Klinik gegangen. Im März 2017 sei eine ambulante Behandlung in der PIA aufgenommen, ab April 2017 wäre eine stationäre Behandlung durchgeführt worden. Die Therapie habe sie „zurück“ in den Alltag gebracht. Derzeit erfolge einmal pro Monat eine Behandlung in der PIA. Bei ausreichender Stabilität strebe sie eine stationäre Traumatherapie an. Eine solche Therapie könne sie sich nur vorstellen, wenn die Tochter mit aufgenommen werde. Eine Psychopharmakatherapie erfolge nicht.
Ihr Alltag sei als Mutter vollständig ausgefüllt. Sie stehe gegen 7.00 Uhr auf, verrichte den Haushalt und die Einkäufe. Ihr Mann sei berufstätig, sie treffe sich mit anderen Müttern zu gemeinsamen Spaziergängen, besuche die Schwiegereltern und unterhalte Kontakte zu einigen Freundinnen. Ihr Putzverhalten wirke sich im Alltag konfliktreich aus. Gewalterfahrungen in der Ehe habe sie nicht gemacht.
Derzeit rauche sie 10 Zigaretten pro Tag. Ab dem 13. Lebensjahr habe sie zahlreiche Drogen wie Joints, Ectasy und Amphetamine konsumiert. Seit dem Wegzug aus H1 2008 habe der Konsum abgenommen, seit vier Jahren bestehe völlige Abstinenz. Alkohol werde selten und nur in geringen Mengen konsumiert. In Kindheit und Jugend sei es zu zahlreichen Straftaten gekommen, aber nie zu einer Gerichtsverhandlung oder einer Verurteilung.
Die Klägerin befinde sich in gutem körperlichen Allgemeinzustand, die Bewegungsabläufe seien unauffällig. Es würden wechselnde körperliche Beschwerden in Abhängigkeit vom aktuellen seelischen Erleben beschrieben. An Händen, Armen und Schulter bestünden großflächige Tätowierungen, die nach Angaben der Klägerin aus den Jahren 2011 bis 2015 stammten.
Die Anreise zur Untersuchung sei selbstständig mit dem PKW erfolgt. Das äußere Erscheinungsbild sei unauffällig, die Klägerin durchgehend freundlich und zugewandt. Eigene Angaben seien lebhaft, teilweise sprunghaft und weitschweifig erfolgt. Es sei jedoch gelungen, die Klägerin immer wieder auf ein vorgegebenes Thema zurückzuführen. Jahreszahlen hätten häufig nur unsicher benannt werden können.
In thematischer Annäherung an die familiäre Situation in der Kindheit und die Schädigungen sei eine Zuspitzung von innerer Unruhe und Anspannung eingetreten. Bei beginnender Hyperventilation sei die Untersuchung unterbrochen und nach 10 Minuten fortgesetzt worden. Deshalb sei auf die Erhebung detaillierterer Angaben verzichtet worden. Gegen Ende der Untersuchung sei eine hinreichende affektive Stabilität für einen selbstständigen Rückweg deutlich und bestätigt worden.
Die Bewusstseinslage sei klar, es ergäben sich keine Hinweise auf akute Intoxikationen. Die Klägerin sei in allen Qualitäten umfangreich orientiert, schwerwiegende Störungen der mnestisch-kognitiven Funktionen bestünden nicht. Die benannten Konzentrationsstörungen seien nicht deutlich geworden, Auffassung und Ausdauer erwiesen sich als weitgehend intakt. Auf Gedächtnisinhalte habe stimmig zueinander zurückgegriffen werden können. Lediglich Jahreszahlen würden nur eingeschränkt erinnert. Die Antriebslage sei gut, die Stimmungslage wechselhaft und instabil. Wiederholt seien stärkere Affekte von Trauer und Enttäuschung deutlich geworden.
Aus der Familienanamnese ergäben sich Hinweise auf mögliche biologische Belastungen mit psychischen Erkrankungen. Soweit den aktuellen Angaben zu entnehmen sei, leide G möglicherweise an einer rezidivierenden depressiven Störung. Bei sämtlichen bekannten Halbgeschwistern würden psychische Erkrankungen bzw. Störungen beschrieben, die allerdings auch teilweise auf die Lebensumstände zurückgeführt werden könnten.
Die Klägerin sei in desolaten familiären Verhältnissen aufgewachsen, der im Haushalt lebende Partner der G habe im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, die Situation der Familie etwas zu lindern. Die Schule sei nur bis zum 5. Schuljahr weitgehend regelmäßig besucht, die schulische Ausbildung im Verlauf der 6. Klasse die schulische Ausbildung weitgehend beendet worden. Im Lebensalter von 14 Jahren habe die Klägerin die Herkunftsfamilie verlassen müssen. Sie sei Beziehungen eingegangen, die zumindest teilweise sehr konfliktbehaftet gewesen seien. Der Drogenkonsum habe reduziert und schließlich eingestellt werden können. Die Klägerin habe sich aus dem Drogen- und Prostituiertenmilieu lösen und eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten abschließen können. Seit 2014 bestehe eine stabile Partnerschaft. Die Klägerin versorge jetzt den Haushalt und die 2018 geborene Tochter. Im Vorerkrankungsverzeichnis der AOK fänden sich Einträge erst ab 2016.
Die Klägerin beschreibe zahlreiche Gesundheitsstörungen, die überwiegend bereits in Kindheit und Jugend aufgetreten seien und weit überwiegend in einem engen inhaltlichen Zusammenhang mit familiärer Situation und erfahrenem sexuellen Missbrauch stünden. Im Zusammenhang mit der Anzeige gegen die Mutter und der Verhandlung vor dem AG sei eine zumindest vorübergehende Zunahme einzelner psychischer Gesundheitsstörungen gut nachvollziehbar.
Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin unter sich aufdrängenden Erinnerungen an die traumatischen Erlebnisse in Kindheit und Jugend leide. Andauernd bestünden erhebliche Ein- und Durchschlafstörungen, teilweise in Verbindung mit belastenden Träumen in diesen Zusammenhängen. Auch im Verlauf der Untersuchung seien bei Erinnerungen an die traumatischen Ereignisse heftige emotionale und vegetative Reaktionen sichtbar und spürbar geworden, sodass auf detaillierte Angaben habe verzichtet werden müssen. Es bestehe eine andauernd erhöhte psychische Sensitivität und Erregbarkeit mit Ein- und Durchschlafstörungen und Reizbarkeit. Orte und Personen, die in Verbindung mit dem damaligen Geschehen stünden, würden möglichst gemieden. Die Klägerin sei bestrebt, Gedanken, Gefühle und Erinnerungen im Zusammenhang mit den traumatischen Erlebnissen zu vermeiden. Andauernd bestehe ein Gefühl der inneren Leere. Die traumatischen Erfahrungen bestimmten zudem Sorgen um die Zukunft und Unversehrtheit des eigenen Kindes. Darüber hinaus bestehe eine emotional instabile Stimmungslage mit rezidivierenden depressiven Beeinträchtigungen sowie zwanghafte Verhaltensweisen.
Diagnostisch sei von einer PTBS auszugehen, diese diagnostische Zuordnung stehe auch in Einklang mit den vorliegenden medizinischen Unterlagen. Schuldgefühle, zwanghafte Anteile sowie rezidivierende depressive Beeinträchtigungen fielen unter dieses Krankheitsbild. Es hätten sich keine Hinweise auf eine schädigungsunabhängige Entwicklung mit psychischen Auswirkungen im Sinne eines sogenannten Vor- oder Nachschadens ergeben. Es werde davon ausgegangen, dass ein in zeitlichem Zusammenhang mit dem erfahrenen sexuellen Missbrauch begonnener zwischenzeitlicher Drogenkonsum sowie Schuldgefühle in Bezug auf das Leiden eines Bruders zumindest in einem engen ursächlichen Zusammenhang mit den geschützten Schädigungen stünden und nicht isoliert betrachtet werden könnten, sondern der posttraumatischen Symptombildung zuzuordnen seien. Die Gewalttat sei wesentliche Bedingung für den Eintritt der Gesundheitsstörungen, das spezifische Milieu habe bei der Entstehung der Gesundheitsstörung mitgewirkt. Die Gesundheitsstörungen lägen durchgehend seit Antragstellung vor und seien mit einem Grad der Schädigungsfolgen (GdS) von 30 zu bewerten.
Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erschienen aktuell weder sinnvoll noch erfolgversprechend. Die Klägerin strebe eine traumatherapeutische Krankenhausbehandlung an, Behandlungsziel solle zunächst eine weitere Stabilisierung der PTBS sein.
Mit Bescheid vom 24. Oktober 2019 stellte der Beklagte fest, dass die Klägerin von 1991 bis 2000 Opfer fortgesetzter, vorsätzlicher, rechtswidriger tätlicher Angriffe geworden ist und erkannte als Schädigungsfolge eine „Posttraumatische Belastungsstörung“ an. Der GdS betrage 30, Anspruch auf Beschädigtengrundrente nach § 30 Abs. 1 BVG bestehe ab dem 1. Mai 2015. Eine Höherbewertung nach § 30 Abs. 2 BVG könne nicht beansprucht werden, Ansprüche auf Ausgleichsrente und Berufsschadensausgleich bestünden nicht. Zur Begründung wurde unter anderem ausgeführt, dass Ausgleichsrente nur von Schwerbeschädigten beansprucht werden könne. Eine Höherbewertung des GdS nach § 30 Abs. 2 BVG oder ein Berufsschadensausgleich könne erst beansprucht werden, wenn erfolgversprechende Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben abgeschlossen seien. Vorliegend sei eine traumaorientierte Therapie erfolgversprechend und zumutbar. Eine solche sei jedoch noch nicht abschließend durchgeführt worden.
Im Widerspruchsverfahren wurde der Entlassungsbericht des Z1 W1 über die stationäre Behandlung der Klägerin vom 21. Januar bis 11. Februar 2020 vorgelegt. Die stationäre Aufnahme sei erfolgt, nachdem die Indikation zu einer hochfrequenten stationären Psychotherapie gestellt worden sei.
Die Klägerin habe berichtet, dass eine Traumatherapie (mit der Tochter) in der K4 in M2 geplant gewesen sei. Den Antrag habe sie nicht abgeschickt, sie sei hierfür nicht stabil genug. Bereits in der Vergangenheit habe es einen ausgeprägten Konsum psychotrop wirksamer Substanzen gegeben. Sie habe im Juni 2019 nach einer Besprechung beim Versorgungsamt in H4 einen Rückfall mit Kokain gehabt. Bei dem Termin sei es um die OEG-Rente gegangen, sie sei erneut mit traumatischen Lebensereignissen konfrontiert worden. Dies habe sie emotional sehr belastet. Sie habe innerhalb einer Woche 17 g Kokain genommen. Seit dem 27. Dezember 2019 konsumiere sie nichts mehr. Momentan habe sie keine Tagesstruktur, könne diese nicht selbstständig aufrechterhalten. Es bestünden Ein- und Durchschlafstörungen, immer wieder konfuse Träume. Tagsüber habe sie vermehrt Bilder an traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die aufkämen. Dissoziationen erlebe sie momentan nicht.
Die Klägerin sei wach, bewusstseinsklar und allseits orientiert gewesen. Im Kontakt zeige sie sich freundlich, habe sehr schnell gesprochen. Es hätten leichte Störungen von Konzentration und Merkfähigkeit bestanden. Es bestünden Albträume, fraglich Intrusionen. Formalgedanklich sei sie geordnet, bei leicht beschleunigtem Gedankengang. Der Affekt sei gedrückt, die Schwingungsfähigkeit reduziert, der Anrieb leicht gesteigert.
Am 11. Februar 2020 habe die Entlassung in behandlungsbedürftigem, aber ausreichend stabilen Zustand in das häusliche Umfeld erfolgen können.
Der Beklagte holte einen Befundschein bei dem Z1-Klinikum W1 ein. Danach werde die Klägerin seit 7. März 2017 in zwei- bis vierwöchigen Intervallen behandelt. Im Behandlungsverlauf habe es immer wieder Zeiten mit unzuverlässiger Terminwahrnehmung und Terminabsagen gegeben, was einerseits mit der Geburt des Kindes und der daraus resultierenden Belastung zu begründen sei, anderseits aber auch als Vermeidungsverhalten eingeordnet werden müsse.
Im Verlauf der Behandlung sei es zu einer erheblichen Verschlechterung gekommen, als die Klägerin erfahren habe, dass sie schwanger sei und insbesondere mit einem Mädchen. Sie habe über vermehrte Albträume, Erinnerungen und Flashbacks berichtet, zweifele an sich, ob sie eine gute Mutter sein könne oder sich die Geschichte wiederhole. Bei einem Besuch in H1 über die Feiertage habe sie vermehrt ab Trauma-Albträumen gelitten.
Durch ein dreistündiges Gespräch mit einem Psychologen zur Begutachtung wegen Opferentschädigung im Juni 2019 sei die Klägerin mit ihrer Kindheit und der gravierenden emotionalen Verwahrlosung konfrontiert worden. Sie sei daraufhin dekompensiert und habe sich auch im Umgang mit ihrer Tochter an die eigene Kindheit erinnert, habe mit ihrer eigenen Mutterrolle und den lange verdrängten Emotionen gehadert. Gleichzeitig hätten sich Übertragungsprozesse mit der Tochter des Ehemannes eingestellt, die sich in regelmäßigen Abständen bei ihnen aufhalte. Die vorhandene Spannung habe die Klägerin mit zwanghaftem Putzen kompensiert, teilweise bis in die Nacht hinein. Weiter seien gesteigertes Kontrollbedürfnis, unkontrollierte Essattacken und, wie sich später herausgestellt habe, auch Kokainkonsum erfolgt.
Beigezogen wurde der Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik L2 über die stationäre Rehabilitation vom 10. Januar bis 28. Juni 2021. Danach könnten keine Tätigkeiten mit Suchtmittelnähe und keine Nachtarbeit verrichtet werden. Ansonsten bestehe für den Bezugsberuf als Rechtsanwaltsfachangestellte sowie bezogen auf die Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes eine vollschichtige Leistungsfähigkeit für mittelschwere Tätigkeiten. Diese Einschätzung sei mit der Klägerin besprochen worden und werde von ihr geteilt. Sie wolle sich zunächst aber weiterhin der Kindererziehung widmen, dann mittelfristig eine neue Anstellung suchen und sich eventuell beruflich umorientieren.
Der Erstkontakt zu Cannabinoiden sei im 11./12. Lebensjahr gewesen, es habe ein schneller Einstieg in den täglichen Konsum bestanden, daneben längere Pausen. Zuletzt habe wieder ein gelegentlicher Gebrauch stattgefunden. Der Erstkontakt mit Kokain sei im Alter von 12 Jahren nach einem Diskobesuch mit Freunden gewesen, ab dem 14. Lebensjahr habe regelmäßiger Konsum an den Wochenenden bestanden, vom 16. bis 21. Lebensjahr täglich. Hypnotika seien im 19./20. Lebensjahr in Verbindung mit dem Kokainkonsum eingenommen worden. Nach Belastung durch die Strafanzeige gegen die Mutter und den Ausbildungsbeginn im 29. Lebensjahr habe wieder täglicher Konsum bis zum Zusammenbruch im 31. Lebensjahr bestanden, seitdem sei sie abstinent. Zu einem Rückfall sei es nach einem Termin beim Versorgungsamt gekommen. Der Erstkontakt zu Amphetaminen sei im 14. Lebensjahr gewesen.
Eine Abhängigkeit von Kokain und Amphetaminen sowie THC mache sie an Konsumzwang, Toleranzentwicklung, zeitweiligem Kontrollverlust, Einschränkung des sozialen Lebens und Ausrichtung der Alltagsgestaltung auf das Suchtmittel sowie einem anhaltenden Konsum trotz schädlicher, vor allem auch gesundheitlicher/sozialer Folgen fest.
Die Klägerin gebe an, dass sie in der Schule der „Klassenkasper“ gewesen sei, habe dadurch sozialen Kontakt zu Freundinnen aufbauen und halten können. Sie sei häufiger von zu Hause weggelaufen, habe aggressives Verhalten gezeigt und leide seit ihrer Kindheit an einer Essstörung (Binge-Eating). Sie habe für ihre jüngeren Geschwister gesorgt. Die Mutter habe oft von ihr verlangt, statt in die Schule zu gehen, den Haushalt zu machen und auf die Geschwister aufzupassen. Ab der 6. Klasse sei sie dann überhaupt nicht mehr zur Schule gegangen. Im 14. Lebensjahr habe sie jedes Wochenende die Diskotheken der R2 besucht, sei morgens von dort direkt in die Schule gegangen. Zeitgleich habe sie sich den sexuellen Missbrauchern verweigert und sei deshalb von der Mutter aus der Wohnung geworfen worden. Sie sei bei ihrem Freund untergekommen, mit 14 Jahren habe sie ihren Lebensunterhalt annähernd selbst finanzieren müssen. Im 21. Lebensjahr habe sie mit ihrem Partner versucht, aus dem Konsum auszusteigen und sei deshalb von H1 weggezogen.
Im 29. Lebensjahr hätten die Belastungen zugenommen, sie habe unter starkem eigenem Druck gestanden, sich zu beweisen und auch ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu schaffen. Sie habe Strafanzeige gegen die Mutter erstattet und die Erinnerungen an die traumatischen Erlebnisse hätten entsprechenden Stress ausgelöst. Sie habe 2017 die Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte geschafft und sei nach der Ausbildung übernommen worden. Aufgrund der traumatischen Erlebnisse sei es zu einem psychischen Zusammenbruch gekommen. Der Arbeitgeber habe ihr gekündigt, seitdem sei sie nicht mehr berufstätig. Die Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte habe ihr gut gefallen und gelegen. Die Kündigung wegen ihres ohnehin erfolgten Umzugs sei für sie passend gewesen, nicht wegen unzureichender Arbeit erfolgt. Sie habe ein gutes Zeugnis erhalten. Es sei eine Begutachtung beim Versorgungsamt erfolgt. Nach der Befragung habe sie unter starken Symptomen der Traumafolgestörung gelitten und wieder zu Konsummitteln gegriffen.
Mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter lebe sie in geordneten Verhältnissen, durch ihren Suchtmittelkonsum sei die Beziehung zum Partner belastet. Im Alltag kümmere sie sich um ihre Tochter, freie Zeit nutze sie meist zum Putzen. Nachts wache sie oft auf und habe Essattacken. Die Klägerin erkläre sich ihre Abhängigkeitserkrankung vor dem Hintergrund der traumatisierenden Gewalterfahrung in ihrer Kindheit. Sie habe den Konsum genutzt, um ihre Gefühle auszuschalten, ihren Körper zu spüren und in Belastungssituationen die Leistungsfähigkeit zu steigern. Zu Rückfällen sei es zuletzt bei der Konfrontation mit den traumatischen Erlebnissen und den belastenden Symptomen der PTBS gekommen.
Die Klägerin sei wach, voll orientiert, freundlich aufgeschlossen und auskunftsbereit. Die Stimmung sei trotz hohem Leidensdruck von Seiten der traumatischen Kindheitserlebnisse ausgeglichen, der Antrieb normal. Es bestehe eine gute affektive Schwingungsfähigkeit, kein Anhalt für Konzentrations-, Auffassungs- und Gedächtnisstörungen.
Als externaler auslösender Stimulus des erstmaligen Suchtmittelkonsums sei die Verfügbarkeit von Kokain und den jeweiligen Drogen im Freundeskreis zu nennen. Internale auslösende Bedingungen für den Suchtmittelkonsum seien Neugierde auf die Wirkung des Suchtmittels und Antizipation einer positiven Wirkung. Faktoren, die die Klägerin vulnerabel gegenüber Suchtmittelkonsum erscheinen ließen, seien eine genetische Disposition durch die spielsüchtige und mutmaßlich depressive Mutter, langanhaltende schwere sexuelle Traumatisierungen und emotionale Vernachlässigung in der Kindheit, überfordernde Verantwortungsübernahme für die vier jüngeren Geschwister und frühe Verselbstständigung im 14. Lebensjahr ohne Schulabschluss, Essstörung und PTBS gewesen. Das letzte Rückfallgeschehen sei vor dem Hintergrund der Konfrontation mit Traumainhalten anlässlich einer Begutachtung vom Versorgungsamt und der verstärkt ausgelösten Symptome der PTBS zu sehen.
Als Reaktion auf der Verhaltensebene erfolge der Suchtmittelkonsum. An unmittelbarer positiver Verstärkung folgten daraufhin eine positiv erlebte Rauschwirkung, eine Stimmungsaufhellung bei depressiver Grundstimmung, eine Selbstwertsteigerung durch gewonnene Leistungsfähigkeit. Unmittelbar negativ verstärkend seien das Nichtwahrnehmen aversiver Emotionen (Angst, Trauer, Wut, Ohnmacht) und Gedanken, kein Hungergefühl mehr wie Entlastung durch Realität ausblenden. Die unmittelbare positive und negative Verstärkung halte den Suchtmittelkonsum aufrecht und chronifiziere ihn. Längerfristig wirksame negative Konsequenzen würden teilweise verhaltenswirksam. Nach Manifestation der Suchtmittelabhängigkeit diene Suchtverlangen als Auslöser des Konsums.
Die Klägerin habe sich am Ende der Behandlung mit ihren erreichten Zielen sehr zufrieden gezeigt. Sie habe sich deutlich gestärkt im Verständnis und im Umgang mit ihrer Abhängigkeitserkrankung erlebt und habe eine klare Abstinenzentscheidung hinsichtlich Alkohol und Drogen getroffen. Sie habe ihre Rückfallsituationen realisiert und ihre erreichten Kompetenzen im Bereich emotionale Stabilisierung, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge und Problemlösungsfertigkeiten als positiv erlebt. Nach der Eingewöhnung der Tochter in den Kindergarten wolle sich die Klägerin im Rahmen einer Halbzeittätigkeit beruflich integrieren.
Bei der Arbeitstherapie habe die Klägerin durchgängig gute Leistungen und Ergebnisse in der internen Belastungserprobung/Arbeitstherapie erbracht. Auffassung von Arbeitsanleitungen und deren Umsetzung seien problemlos erfolgt. Die Klägerin habe sich sehr gut in die Arbeitsgruppe integrieren können, die interpersonelle Interaktion sei immer angemessen, freundlich und kooperativ gewesen. Die Stimmungslage habe sich erfreulich stabilisiert und sie habe Entwicklungsschritte bezüglich der Verarbeitung belastender Lebensereignisse vollziehen können, sodass sie mittelfristig auch eine ambulante Traumatherapie anstrebe.
Auf die Untätigkeitsklage vom 18. August 2022 verpflichtete das Sozialgericht Heilbronn (SG – Az.: S 7 VG 2099/22) den Beklagten mit Gerichtsbescheid vom 5. April 2023 zur Bescheidung des Widerspruchs.
G3 führte versorgungsärztlich aus, dass die neu vorgelegten Unterlagen zu keiner Änderung der bisherigen Beurteilung führten. Der Entlassungsbericht des Klinikums W1 vom 7. Februar 2020 dokumentiere eine stationäre Behandlung bei krisenhafter Verschlechterung der Traumafolgestörung auch mit wieder aufgenommenem Drogenkonsum. Als Ergebnis der dreiwöchigen Behandlung habe eine gute Stabilisierung bei weiter bestehender Behandlungsbedürftigkeit erreicht werden können. Der Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik L2 dokumentiere eine fünfeinhalbmonatige erfolgreiche Langzeitentwöhnungsbehandlung bei multipler Substanzabhängigkeit. In der sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung werde eine vollschichtige Leistungsfähigkeit für mittelschwere Tätigkeiten bezogen auf ihren Beruf als Rechtsanwaltsfachangestellte sowie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesehen. Aus den Angaben zur Arbeitsanamnese gehe hervor, dass die Kündigung 2017 seitens des Arbeitsgebers wegen eines Umzuges passend gewesen und nicht wegen unzureichender Arbeit erfolgt sei. In der Arbeitstherapie seien durchgängig gute Leistungen und Ergebnisse in der internen Belastungserprobung erbracht worden. Im Ergebnis werde der Behandlungsverlauf der Langzeitentwöhnungsmaßnahme als positiv beurteilt, die gesetzten Therapieziele seien weitgehend erreicht, die Abstinenzmotivation und -zuversicht sei von Seiten der Versorgungsberechtigten als stabil eingeschätzt worden. Von einer anhaltenden schädigungsbedingt relevanten beruflichen Beeinträchtigung könne daher nicht ausgegangen werden. Für eine Höherbewertung der anerkannten Schädigungsfolgen ergebe sich ebenfalls keine ausreichende Grundlage.
Den Widerspruch wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 14. Juni 2023 zurück. Der angefochtene Bescheid entspreche der Sach- und Rechtslage, wie sich auch aus der versorgungsärztlichen Stellungnahme ergebe. Entgegen einer zunächst anders lautenden Mitteilung verfüge die AOK H4-F3 über keine weiteren Berichte, die noch hätten beigezogen werden können.
Am 14. Juli 2023 hat die Klägerin erneut Klage beim SG erhoben, welches zur weiteren Sachaufklärung Behandlungsberichte der behandelnden Kliniken beigezogen hat. Der Diakonie Kreisverband H4 hat die Befund- und Behandlungsberichte vorgelegt. Im Abschlussbericht für Nachsorgeleistungen bei Abhängigkeitserkrankungen ist dargelegt, dass die Klägerin aus der Langzeitrehabilitation vieles mitgenommen habe, das ihre Abstinenz unterstütze. Sie befinde sich nach einem Rückfall und dessen Aufarbeitung in einer Umstrukturierung ihres Lebens. Dieser Prozess sei noch nicht abgeschlossen und erfordere weitere Begleitung. Hierzu zähle der Wiedereintritt in eine Erwerbstätigkeit und – nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten – der Aufbau von stabilen sozialen Strukturen. Hinzu komme, dass die Klägerin noch keinen Therapeuten für ihre Traumata gefunden habe.
Das Z1 Klinikum W1 hat einen Behandlungsbericht übersandt, wonach die Klägerin im Oktober 2022 nach einjähriger Pause wieder Kontakt aufgenommen und über eine Untätigkeitsklage wegen des unbearbeiteten Widerspruchs berichtet habe. Die psychische Situation habe sich in den letzten Wochen wieder verschlechtert. Sie habe hohen Suchtdruck, sei deshalb auch nicht nach H1 gefahren, obwohl sie dies bereits geplant gehabt habe. Sie vermute, dass diese Verschlechterung mit der Untätigkeitsklage zu tun habe.
Weiter sind die Verlaufsberichte der PIA vorgelegt worden, aus denen sich hinsichtlich einzelner Behandlungsdaten im Wesentlichen Folgendes ergeben hat:
27. Juni 2017: Die Klägerin sei freundlich zugewandt, entspannt und schwingungsfähig gewesen sei. Sie sei in ausgeglichener Stimmung, habe einen guten Antrieb. Konzentration, Merkfähigkeit und Gedächtnis seien unauffällig, das Denken geordnet. Der weitere Behandlungsverlauf sei geplant worden. Die Klägerin habe angegeben, dass Juni 2017 der Termin für die standesamtliche Hochzeit sei, Juli 2017 derjenige für die kirchliche Hochzeit undim September 2017 Gerichtstermine im „Revisionsverfahren“.
16. August 2017: Die Klägerin habe entspannt, ausgeglichen und energiegeladen gewirkt. Merkfähigkeit und Gedächtnis seien unauffällig, das Denken geordnet. Es bestünden keine Flashbacks und keine Albträume, es werde über schlechten Schlaf ohne Erschöpfung am Tag berichtet.
19. September 2017: Die Klägerin sei entspannt und ausgeglichen. Merkfähigkeit und Gedächtnis seien unauffällig.
26. Oktober 2017: Die Klägerin sei schwanger und schockiert, dass es eine Tochter werde. Sie habe sich einen Sohn gewünscht. Ihr Mann habe zwar Verständnis, sei über die Reaktion aber irritiert. Aus der Familie komme wenig Verständnis für ihre Reaktion. Die Klägerin habe Angst, keine ausreichende Bindung zu der Tochter aufbauen zu können, da sie selbst keine Bindungserfahrung mit ihrer Mutter gemacht habe. Durch den Umgang mit den Brüdern als „Ersatzmama“ sei sie bestärkt darin, mit einem Sohn gut umgehen zu können. Die Klägerin habe etwas angespannt gewirkt, es bestehe ein leichter Stimmungseinbruch durch die unerwartete Schwangerschaft. Merkfähigkeit und Gedächtnis seien unauffällig. Das Denken sei geordnet, es bestünden keine Flashbacks und keine Albträume.
7. Dezember 2017: Die Klägerin habe entspannt gewirkt und von plötzlichen Stimmungsschwankungen berichtet. Sie sei informiert worden, dass G per Gutachten für schuldfähig erklärt worden sei und die Revision zurückgezogen habe. Das Thema sei für die Klägerin dadurch beendet, was sehr entlastend sei. Mit der Tatsache, dass das Kind ein Mädchen werde, habe sie sich arrangiert. Die Grundstimmung sei gut gewesen, Merkfähigkeit und Gedächtnis unauffällig. Es bestünden keine Flashbacks und keine Albträume.
3. Januar 2018: Die Klägerin habe angegeben, an Weihnachten bei ihrer Familie in H1 gewesen zu sein. Sie habe es genossen, bei ihrer Familie zu sein, dennoch habe sie Albträume gehabt, was hier so gut wie nicht mehr vorkomme. Am 23. Februar 2018 sei die Grundstimmung gut gewesen, der Schlaf als gebessert angegeben worden, Flashbacks und Albträume hätten keine bestanden.
4. April 2018: Es sei über eine anstrengende Geburt der Tochter berichtet worden. Die Klägerin habe entspannt gewirkt, bei noch bestehenden Stimmungsschwankungen und leichter Gereiztheit. Die Grundstimmung sei gut, Merkfähigkeit und Gedächtnis zeigten sich unauffällig. Momentan sei der Schlaf gestört und unterbrochen. Flashbacks und Albträume bestünden nicht. Entsprechendes ist am 4. Mai 2018 beschrieben worden. Am 22. Mai 2018 ist vermerkt, dass eine gute Bindung zum Kind bestehe. Alte Erinnerungen würden durch die Versorgung des Säuglings getriggert, dabei tauchten auch viele Gefühle auf. Es komme vermehrt zu Albträumen nachts mit dem Inhalt Verantwortung/Schutz anderer Personen/Schuld. Daran merke die Klägerin, dass das Thema noch nicht erledigt sei.
28. August 2018: Die Klägerin habe von einer bevorstehenden Reise nach H1 berichtet. Sie überlege, ob sie G in der Haft besuchen solle. Wegen der Situation mit der Tochter bestehe aktuell eine vermehrte PTSD-Symptomatik, die auch den Wunsch nach Liebe durch die eigene Mutter wecke. Sie könne nicht glauben, dass G bei fünf Kindern überhaupt keine positiven Emotionen gehabt habe.
4. April 2019: Es sei über wiederkehrende Konflikte mit dem Ehemann berichtet worden. Die Klägerin habe versucht, mit ihrem Mann über Erziehung, Werte, ihre Gefühle und Erwartungen zu reden. Er sei jedoch wenig initiativ, wisse oft nichts dazu zu sagen und beziehe keine Stellung. Sie habe manchmal den Eindruck, ein zweites Kind zu erziehen. Die Klägerin gehe häufig erst nach Mitternacht ins Bett, komme schlecht zur Ruhe und wache wegen der kleinen Tochter auf.
19. Juni 2019: Die Klägerin sei derzeit eher destabilisiert wegen des Gutachtens. Dies habe viel aufgewühlt, sie sehe sich auch mit eigenen Ansprüchen an die Rolle als Mutter wieder vermehrt konfrontiert. Bei dem Gutachten sei es weniger um die schlimmen Taten gegangen, mit denen sie gut umgehen könne, als vielmehr um die emotionale Verwahrlosung von ihr und ihren Geschwistern, der desolaten Lebenssituation von damals und dem Umgang damit. Sie werde auch im Umgang mit ihrer Tochter immer wieder an ihre Kindheit erinnert. Ebenso liefen Übertragungsprozesse mit der Tochter des Ehemannes. Erst seit dieser Woche bekomme sie ihren Alltag wieder hin.
23. Juli 2019: Die Klägerin sei wach, bewusstseinsklar und allseits orientiert gewesen. Konzentration, Auffassungsgabe, Merkfähigkeit und Gedächtnis sowie die Kritikfähigkeit seien objektiv nicht beeinträchtigt. Subjektiv würden Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen angegeben. Der formale Gedankengang sei geordnet, die Stimmung sei aktuell belastet. Die Psychomotorik sei unruhig, der Antrieb uneingeschränkt. Am 21. August 2019 sei berichtet worden, dass der Kroatien-Urlaub mit der Familie anstrengend gewesen sei. Sie habe jetzt gleich noch einen Aufenthalt in einem Familienhotel gebucht.
18. September 2019: Die Klägerin habe ihre psychotische Oma aus H1 erst zu sich geholt, dann aber wieder zurück nach H1 ins Krankenhaus gebracht habe. Am 13. Dezember 2019 habe sie angegeben, seit dem Begutachtungstermin beim Versorgungsamt kompensatorisch Kokain zu konsumieren. Sie konsumiere ein- bis zweimal wöchentlich, wenn ihre Tochter nicht anwesend sei. Sie merke kaum eine Wirkung des Kokains, am ehesten eine Beruhigung der Gedanken.
Anschließend hat das SG das psychiatrisch-neurologische Sachverständigengutachten des G1 aufgrund ambulanter Untersuchung vom 2. September 2024 erhoben. Diesem gegenüber hat die Klägerin angegeben, dass sie jetzt drei Wochen kinderfrei gehabt habe. Sie sei alleinerziehend, der Vater der Tochter habe diese in den Ferien bei sich gehabt. Sie habe gearbeitet, sei zu Hause gewesen. Sie habe eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten bestanden, sei aufgrund von Depressionen wieder gekündigt worden. Es sei nicht gesagt worden, dass die Kündigung aufgrund von Depressionen sei. Sie schlafe nicht durch, insgesamt schlafe sie fünf Stunden.
Sie habe jede Nacht „verschiedene“ Albträume. Auf Nachfrage: Es sei die familiäre Situation in der Kindheit, bestimmte Bilder könne sie nicht benennen. Auf weitere Nachfrage zu der familiären Situation habe die Klägerin geschildert, dass sie fünf Geschwister habe, vier davon jünger. Die Geschwister seien in ein Heim gekommen, zuvor habe sie sich um die Geschwister gekümmert. Sie habe den Haushalt gemacht, ihre Geschwister zum Kindergarten gebracht. Zu den Geschwistern habe sie guten Kontakt. Sie habe eine ganze Zeit nicht nach H1 fahren können. An die Stadt habe sie schlechte Erinnerungen, sie meine damit, dass sie suchtkrank sei. Ein- bis zweimal pro Jahr sei sie nach H1 gefahren, aktuell fahre sie fünf- bis sechsmal pro Jahr dorthin. Zuletzt sei sie im April in H1 gewesen, ihre beste Freundin sei für sie wie eine Schwester. Sie fühle sich dort einfach sicher, kenne die Freundin noch aus dem Kindergarten.
Vom 19. bis 24. August sei sie mit ihrem Bruder, einem Neffen und ihrer Tochter in Holland gewesen. Sie hätten ein Hausboot gemietet. Dort habe sie einen Zug von einem Joint genommen. Sie konsumiere ab und zu Cannabis, wenn die Kinder nicht da seien.
Seit ihrer Diät esse sie weniger. Sie gehe ins Fitnessstudio und sei mit der Tochter viel Fahrrad gefahren. Sie habe Essattacken, einige Zeit seien diese jede Nacht vorgekommen, mittlerweile selten. Ihr Interesse an Sexualität sei wieder vorhanden. Sie sei aktuell nicht in einer Beziehung, sie hätten sich getrennt. Mit dem Ehemann sei sie sieben Jahre verheiratet gewesen. Im Mai 2022 hätten sie sich getrennt. Sie hätten fünf Jahre nicht miteinander geschlafen, seitdem sie schwanger gewesen sei. Zuvor hätten sie eine gute Sexualität gehabt. Vielleicht sei es auch die Gewichtszunahme bei ihr gewesen.
Ihre Konzentrationsfähigkeit sei teilweise sehr schlecht. Auf der Arbeit sei sie sechs Stunden, dann sei sie erschöpft. Abends, wenn sie ins Bett gehe, grübele sie. An Ängsten leide sie nicht, habe keine „ungesunden Ängste“. In Bezug auf Mutter und Tochter habe sie enorme Angst. Sie habe Angst, nicht gut genug zu sein. Sie sei in schlechten Verhältnissen aufgewachsen, habe nie Liebe erfahren, sei immer „Schuld“ gewesen. Sie habe anfangs Probleme damit gehabt, mit einem Mädchen schwanger zu sein. Seitdem sie nicht mehr arbeite, sei ihre Stimmung besser. Sie sei nicht mehr so angespannt, vorher sei der Alltag mit der Arbeit hektisch gewesen. Es habe nur einen Suizidversuch mit 16 Jahren mit Tabletten gegeben.
Früher habe sie Kokain konsumiert, ihre Sorgen und Probleme seien dann weg gewesen. Die Begutachtung sei 2018 oder 2019 gewesen. Zwei Jahre habe sie konsumiert. Die Situation in der Ehe sei unerträglich gewesen, es habe allmählich zugenommen. Sie habe Angst gehabt, dass ihr die Kinder weggenommen würden, sie habe keinen Ausweg gesehen.
Der letzte Kokain-Konsum sei Februar, März 2024 gewesen, der letzte Amphetamin-Konsum nicht lange her. Es sei gewesen, als ihre Tochter nicht zu Hause gewesen sei. Sie habe vor zehn bis zwölf Tagen zusammen mit ihrer Schwägerin „Speed“ konsumiert. Alkohol trinke sie selten. Sie sei nie inhaftiert gewesen, habe nie Straftaten begangen. Als Jugendliche habe sie mal Kleidung gestohlen, sei aber nicht bestraft worden, da sie nicht strafmündig gewesen sei.
G habe als Prostituierte gearbeitet, der Vater sei nicht ihr leiblicher Vater. Sie hätten immer ein gutes Verhältnis gehabt, der Kontakt sei vor vier bis fünf Jahren abgebrochen. Es sei gewesen, als G inhaftiert worden sei. Sie habe gedacht, er werde sich von G trennen. Der Vater habe einen schweren Unfall gehabt, 26 % der Haut seien verbrannt. Sie seien hingefahren und hätten viel gemacht. Als sie – gemeint wohl G – entlassen worden sei, sei der Vater zu dieser zurückgekehrt. Deshalb sei der Kontakt abgebrochen worden. Sie habe immer versucht, die Liebe der Eltern zu bekommen, habe keine Liebe bekommen. Auch zu G habe sie keinen Kontakt. Der Kontakt sei vor 15 Jahren abgebrochen, G habe den zehnjährigen Bruder am Bahnhof stehen lassen.
Von zu Hause ausgezogen sei sie mit 14 Jahren. Im Alter von 14 bis 20 Jahren habe sie einen Freund gehabt und mit ihm in einer Wohnung zusammengelebt. Sie habe durch ihren Konsum in den Tag hineingelebt, gefeiert. Sie sei 14 gewesen, habe auf der R2, in Diskotheken gefeiert. Sie sei von ihren Eltern finanziell unterstützt worden. Am Wochenende sei sie einkaufen gegangen, habe 50 DM von ihrem Vater erhalten und den Großeinkauf für die Familie gemacht. Auf Nachfrage: Ihre Freunde seien vorbeigekommen und sie hätten die Einkäufe nach Hause getragen. Mit Geld habe sie keine Probleme gehabt, sie habe immer Geld gehabt. Mit ihrem Freund habe sie bis zum Alter von 16 Jahren zusammengelebt, sei dann zu ihrer besten Freundin gezogen. Erst habe sie bei deren Eltern gelebt. Ihre Freundin habe eine Beziehung gehabt, sie hätten zu dritt in einer Wohngemeinschaft gelebt. Sie habe keine Miete bezahlen müssen und das Kindergeld erhalten. Den Konsum hätten sie durch einen Freund finanziert, der Drogen verkauft habe.
Mit 18 habe sie kurzzeitig eine Beziehung gehabt und sei nach I2 weggegangen. Die Beziehung sei nicht glücklich gewesen, nach einem halben Jahr sei sie zurückgekommen. Sie sei wieder zu den Eltern ihrer besten Freundin gezogen, habe eine Wohnung in der Nähe der R2 gehabt. Im Alter von 19 bis 20 Jahren habe sie ein Internetcafe mit einer Bar betrieben, ihr Freund habe es finanziert. Sie habe dann ihren Exfreund kennengelernt, sei deshalb nach N2 gezogen. Als sie sich getrennt hätten, habe sie mit einer Freundin in A2 gewohnt (2012). Im Kern sei sie beruflich in einer Wohnung gewesen, habe Prostitution betrieben. Sie habe begonnen, als sie auf jeden Fall 18 Jahre alt gewesen sei. Sie habe damit Geld verdient, ihre Geschwister finanziert, die im Heim gewesen seien. Sie hätten Geld gebraucht, keine Wohnung gehabt. Bis 2017 sei sie der Prostitution nachgegangen. Es habe ein Aussteigerprogramm gegeben, in diesem Rahmen sei sie zu dem Anwalt gekommen. Seit 2020 oder 2021 wohne sie in R3, 2017 habe sie geheiratet.
Auf die Frage, wann die Symptomatik einer PTBS am schlimmsten gewesen sei, habe die Klägerin angegeben, nach der Begutachtung. Das sei ja „bewiesen“. Dadurch sei ihr bewusst geworden, was es ausmache, emotional vernachlässigt worden zu sein, nicht geliebt und gewollt gewesen zu sein, geschlagen zu werden. Dies sei schlimmer als die sexuellen Taten. Ihre Eltern hätten einen IQ „von Raumtemperatur“. Es habe viel Gewalt gegeben, es sei immer laut gewesen, es habe Schläge gegeben und den Missbrauch. Sie habe immer verdrängt, dass sie keine Emotionen gegenüber G empfinde. Das sei ihr damals bewusst geworden, sie sei nie geliebt worden. Es habe nicht eine Situation gegeben, in der sie in den Arm genommen worden sei. G habe sie auch zu den Männern mitgenommen. Wenn sie ihre Tochter ansehe, frage sie sich, wie man dies einem Kind antun könne.
Die „PTBS“, Albträume, Flashbacks und Schreckhaftigkeit habe sie schon in der Schule gehabt, sei öfter bei ihrer Oma gewesen. Dort habe sie keine Albträume gehabt. Zwischen 15 und 20 Jahren sei sie aufgrund der Ereignisse auch lebensmüde gewesen. Sie „glaube“, dass die Symptomatik gleichbleibend sei.
Sie könne sich an die Ereignisse erinnern. G habe gewollt, dass sie beim Hausmeister schlafe. Er habe sie missbraucht. Sie sei die Steintreppe hochgegangen, habe im Alter zwischen acht bis zehn Jahren im Treppenhaus übernachtet. Sie könne nicht genau sagen, ob sie damals Albträume gehabt habe. Flashbacks habe sie täglich. Es seien Bilder, was den Missbrauch angehe. Ihre Therapeutin habe ihr geraten, rote Gegenstände zu zählen. Sie stelle sich vor, wie eine Wand zwischen ihr und den Bildern hochzufahren. Es funktioniere teilweise.
Depressiv sei sie aktuell nicht. Depressiv sei sie gewesen, wenn ihr alles zu viel gewesen sei. Es gebe Phasen, in denen sie „todtraurig“ sei, sich zurückziehe. Sie habe keine Depressionen gekannt. In Phasen von Depression sei ihr Antrieb schlechter. Sie habe solche Phasen alle zwei Wochen, wenn ihre Tochter nicht da sei.
Die Sucht sei bis zum 20./21. Lebensjahr am schlimmsten gewesen. Nach der Begutachtung sei es extrem gewesen, sie habe Kokain konsumiert. Einmal drei Tage hintereinander am Stück, als ihre Tochter nicht da gewesen sei.
G habe sie 2014 angezeigt, 2016 sei die Verhandlung gewesen. Eine schwere Phase der Depression habe sie nach der Verhandlung durchlitten, während der Ausbildung. Sie habe in die Berufsvorbereitung gesollt, da sei es am Schlimmsten gewesen. Sie habe nur im Bett gelegen, sei auch neun Wochen in der Klinik in W2 behandelt worden. 2017 sei sie erstmals psychiatrisch therapiert worden. Im Traumazentrum F2 sei sie während der Ausbildung 2016 vorgestellt worden. Es habe geheißen, sie solle nicht aufarbeiten, weil die Traumatisierungen ein Risiko hätten, dass „es wie es dann passiert sei, passiere“. Aktuell fänden psychotherapeutische Termine alle 14 Tage statt. Escitalopram nehme sie seit sechs Wochen, für die Untersuchung sei es wieder abgesetzt worden. Im Erwachsenenalter seien keine sexuellen Übergriffe vorgekommen. Gewalt habe sie durch ihren Exfreund erfahren, der sie geschlagen habe.
In der Schule sei sie durch Mitschüler gemobbt worden. In der ganzen Kindheit sei ihr vermittelt worden, dass sie weniger wert sei als andere. Sie habe sich körperlich nicht durchsetzen können. In der Jugend habe sie erlebt, dass sich andere gegen sie abgesprochen hätten. Mit 14 sei sie ausgezogen, habe über lange Zeiträume selbst zurechtkommen müssen. Ihre Geschwister seien immer bevorzugt worden.
Von ihren Eltern sei sie weniger gelobt worden als andere Kinder. Sie habe erhebliche körperliche Gewalt erfahren. Im Alter zwischen 6 und 14 Jahren sei sie sexuell missbraucht oder vergewaltigt worden. Ihre Eltern seien ganz grausam zu ihr gewesen, hätten sie gequält. Ihr Vater habe getrunken, was kein Problem gewesen sei. Über einen längeren Zeitraum habe sie möglicherweise nicht genügend zu essen gehabt, ihre ganze Kindheit sei unter sozial schwierigen Umständen gewesen. Sie sei in Armut aufgewachsen, sei vernachlässigt worden, habe Verwahrlosung erlebt.
Die Klägerin gebe an, keine Beziehung mehr eingehen zu wollen. Sie habe Verabredungen für Sexualkontakte. Aktuell lebe sie von Krankengeld, Leistungen wegen Berufsunfähigkeit erhalte sie nicht. Sie lebe in einer 80 qm großen Wohnung zur Miete, sie nutze den PKW von einer Freundin. Schulden bestünden nicht.
Ihre Hobbys seien Lesen, Reisen und Kochen, zudem gehe sie ins Fitnessstudio. Urlaub habe sie zuletzt in Holland gemacht, im letzten Mai eine Kreuzfahrt mit der Aida. Sie habe ein paar enge Freunde, eine engste Freundin. Um ihren Haushalt kümmere sie sich selbst.
Es hätten keine Bewusstseinsstörungen bestanden, die Orientierung zu Zeit, Ort, Situation und Person sei vorhanden. Die Auffassung zeige sich regelrecht, Aufforderungen seien verstanden worden. Eine Konzentrationsstörung sei im Gespräch nicht deutlich geworden. Angegeben worden seien Nachhallerinnerungen in Form von Flashbacks. Eine dissoziative Amnesie habe nicht bestanden, auch keine Gedächtnisstörungen. Die Klägerin könne Handlungsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge bringen und sei nicht desorganisiert. Das Interview sei nicht durch formale Denkstörungen erschwert, der Gesprächsablauf sei zügig, die Antworten geordnet und zielgerichtet. Das Denken sei nicht auf wenige Inhalte eingeschränkt.
Die Klägerin sei nicht misstrauisch, der Alltag werde nicht durch ängstliches Vermeidungsverhalten beeinträchtigt. Sie habe weder ängstlich noch besorgt gewirkt. Die Klägerin wirke wie jemand, der sich zurechtfinde und nicht ratlos sei. Die Grundstimmung sei nicht depressiv, sondern ausgeglichen. Das Wohlbefinden sei nicht übersteigert, nicht euphorisch. Sie habe teils etwas übellaunig gewirkt. Die Stimmung sei auch bei negativen Themen, wie dem sexuellen Missbrauch, stabil gewesen. Tränen habe sie bei der Aufklärung über die Beweisfragen und das Thema ihres Bruders in den Augen gehabt, es habe sich um eine diskrete themenbezogene Labilität des Affekts gehandelt, keine allgemeine Affektlabilität. Interesse und Freude seien aus der positiven emotionalen Resonanz bei positiven Themen ganz klar deutlich geworden. Das Vitalgefühl habe gut gewirkt, der Vortrag deutlich klagsam. Gefühlsausdruck und berichteter Inhalt hätten nicht immer übereingestimmt.
Es sei eine gute Gesprächsinitiative geboten worden, die Lebendigkeit und Tatkraft seien nicht in einem den Alltag beeinflussenden Ausmaß herabgesetzt. Die Klägerin wirke antriebsstark und sei motorisch ruhig. Die Psychomotorik sei insgesamt nicht gesteigert oder vermindert.
Ein sozialer Rückzug sei aus dem Bericht nicht deutlich geworden, aktuelle Suizidgedanken verneint worden. Durchschlafstörungen oder Früherwachen seien aus dem Bericht nicht deutlich geworden, die Klägerin habe nicht müde gewirkt. Parasomnien in Form von Albträumen würden berichtet. Der Appetit sei erhalten, die Sexualität werde als nicht vermindert berichtet. Schmerzen prägten den Fall nicht. In der körperlichen Untersuchung hätten sich keine Zeichen für Schmerzen gezeigt.
Zu diagnostizieren seien psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch, eine rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert, und eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. In der Laboruntersuchung habe sich eine Vergiftung mit Amphetamin ergeben, ein sehr hoher Wert, der den Grenzwert für das Führen eines Kraftfahrzeugs um mehr als das Zehnfache übersteige. In der testpsychologischen Untersuchung hätten sich keine Hinweise auf eine Depression gefunden.
Die Klägerin zähle ihre Beschwerden mit Fachausdrücken in einem formalen Antwortstil ohne emotionale Beteiligung auf. Sie sei dabei vage und undeutlich. Der objektivierbare Befund mit ruhigem Bericht mit dem Aspekt eines normalen Gesprächs bei den schwerwiegenden Themen habe nicht für eine PTBS gesprochen. Trotz Vergiftung mit Amphetamin sei sie nicht getrieben und nicht beschleunigt gewesen. Die Auffälligkeiten im Gespräch wiesen auf eine leichtgradige Persönlichkeitsstörung hin. In der Summe passe der Befund nicht zu einer erheblichen PTBS. Es bestünden Schwierigkeiten mit dem Zeitverlauf der Symptome, teils werde häufiger in Folge ein unauffälliger psychischer Befund berichtet. Zu relevanten Behandlungen sei es erst nach der Strafanzeige und im Rahmen des OEG-Verfahrens gekommen.
Der berichtete Alltag und die Alltagsbewältigung seien weitgehend unauffällig, die Klägerin gebe gute soziale Kontakte an und habe positive Aktivitäten unternommen, sei berufstätig. Die späte erste psychische Behandlung spreche gegen eine erhebliche Schwere der vorherigen Symptomatik. Die Behandlung in der PIA sei nicht sehr intensiv gewesen. Die testpsychologische Untersuchung könne nur mit Vorsicht interpretiert werden, da die Testverfahren für Situationen, in denen sich Dissimulation – wie hinsichtlich des Substanzkonsums – und Aggravation mischten, nicht validiert seien.
Aus den Selbstbeurteilungsbögen folge eine schwere Symptomatik einer PTBS, was weder mit dem Verlauf, noch mit dem klinischen Befund in Einklang zu bringen sei. Wenn gleichzeitig im BDI-II nur eine minimale Depression zur Darstellung komme, sei dies ein nicht wahrscheinliches Ergebnis, da Menschen mit einer PTBS oft hohe Werte im BDI-II hätten. Escitalopram sei nicht nachzuweisen gewesen, auch das Abbauprodukt Desmethylescitalopram nicht. Nachdem die Klägerin über eine Blutentnahme aufgeklärt worden sei, habe sie angegeben, dass das Medikament im Vorfeld der Begutachtung abgesetzt worden sei. Wenn es zutreffend wäre, dass die Klägerin – wie sie angebe – durch gutachterliche Gespräche retraumatisiert werde, sei das Wahrnehmen eines solche (medikamentösen) „Puffers“ gerade vor einem solchen Gespräch zu erwarten. Wenn somit für eine gutachterliche Untersuchung schützende Medikamente abgesetzt würden, habe dies keinen therapeutischen Hintergrund. Dies wäre nämlich nichts anderes als eine Abhängigkeit der Therapie von Begutachtungen oder im Kontext im Verfahren.
Die Angabe von täglichen Albträumen und Flashbacks sei bei lange zurückliegenden Traumata nicht wahrscheinlich. Die Berichte dazu seien nicht plastisch, sondern ausweichend, oberflächlich bleibend gewesen, die Klägerin dabei auch gelassen. Eine emotionale Belastung sei weder beim Thema Symptome noch bei traumatisierenden Ereignissen deutlich geworden.
Vermeidungsverhalten habe sich keines gezeigt, weder durch die eigene Tätigkeit auch im Bereich Sexarbeit noch in Bezug auf die Vermeidung etwa von Orten in H1. Es sei vielmehr so gewesen, dass sie ihre Bindungen in das Umfeld in Bezug auf ihre Geschwister und ihre beste Freundin aufrechterhalten habe. Langjährige Sozialkontakte zeigten eine nicht geringe soziale Anpassungsfähigkeit. Die Klägerin habe bis zur Geburt der Tochter nach eigenen Angaben eine sexuell erfüllte Beziehung erlebt. Es sei eine Situation ohne relevante Störungen gewesen, sozial wie im Bereich der Nähe. Wenn gleichzeitig angegeben werde, dass die Symptome einer PTBS über die Zeit im Wesentlichen konstant gewesen seien, sei dies eine erhebliche Inkonsistenz. Eine zumindest mögliche Verschleierung werde auch darin deutlich, dass die Akte nicht ausreichend lange zurückreiche.
In der Summe hätten erhebliche Probleme mit der Plausibilität bestanden. Eine schwere negative Verzerrung auf der einen und Dissimulation auf der anderen Seite hätten nicht ausgeschlossen werden können. Eine erhebliche Aggravation sei vielmehr wahrscheinlich.
Eine chronische PTBS sei nicht mit ausreichender Gewissheit festzustellen. Die Klägerin habe zwar schwere Ereignisse erlebt, die der Eingangsbedingung für eine PTBS genügten, jedoch ergäben sich Probleme mit dem Schweregrad und dem Verlauf. Es sei unplausibel, dass die Symptome einer PTBS in der ambulanten Berichterstattung als remittiert anhand der psychischen Befunde beschrieben worden seien, jetzt aber wieder so schwer sein sollten.
Auch sei der Verlauf untypisch mit Angabe einer Retraumatisierung oder starken Verschlimmerung durch eine Begutachtung. Im Einzelfall könne es einmal sein, dass bei schweren Traumatisierungen Symptome im Umfeld von Begutachtungen stärker würden, eine Retraumatisierung sei dies aber nicht. Auch spreche dagegen, dass die Klägerin eigeninitiativ auf das Thema gelenkt habe und über die Situation, dass sie zu Männern der G mitgenommen worden sei, ohne emotionale Reaktion habe sprechen können. Dies zeige einen geringen Schweregrad oder eine gute Verarbeitung an. Aus der Akte ergebe sich auch, dass die Klägerin mehrfach über die Ereignisse habe berichten können.
Wenn die Klägerin 2014 bis 2017 eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten erfolgreich absolviert habe, sogar gute Noten geschafft habe, widerspreche dies auch einem damaligen Vollbild einer PTBS, da eine erhebliche Krankheitsschwere für das Vollbild gefordert sei (sog. G-Kriterium). Dieses besage, dass in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen bestünden. Davon könne man sich anhand der Befunde und des beruflichen Werdegangs nicht überzeugen. Der Bericht aus der Psychotherapie 2009, in dem die Heilpraktikerin eine PTBS beschreibe, reiche nicht aus, um Brückensymptome als bestehend annehmen zu können.
In der Summe seien die Ereignisse zwar geeignet gewesen, es fänden sich aber viele Probleme mit der Diagnose einer PTBS. Der Bericht über tägliche Albträume oder Flashbacks dürfe nicht unkritisch in die Diagnose übersetzt werden. In der Untersuchung sei ein solches Störungsbild nicht plausibel geworden. Es könne zwar sein, dass eine leichtere Teilsymptomatik bestehe, jedoch verstelle eine erhebliche Verzerrung den Blick.
Hinsichtlich des Substanzkonsums werde die Diagnostik durch die Dissimulation erschwert. Dies gelte auch dann, wenn die Klägerin in einer nachträglichen E-Mail den Substanzkonsum eingeräumt habe, da damit angezeigt werde, dass sie im Gespräch zu dem Bereich keine aussagekräftigen Angaben gemacht habe. Aus der Akte ergebe sich eine Störung durch multiplen Substanzgebrauch. Eine Abstinenz habe nicht bestanden, der Amphetamin-Wert sei zehnmal höher als der Grenzwert für die Führung eines Kraftfahrzeugs, dennoch sei die Klägerin mit dem PKW zur Untersuchung gekommen. Das Gesamt-Ausmaß des Konsums sei bei Dissimulation unklar geblieben, allerdings sei ein Mischkonsum hier sehr wahrscheinlich.
Bei der Klägerin liege eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor. Eine Persönlichkeitsstörung werde nicht nur im SKID-5-Screening angezeigt, die Biographie und negative Ereignisse machten eine abweichende Persönlichkeitsentwicklung nicht unwahrscheinlich. Delinquenz sei dokumentiert worden. In solchen Umfeldern und bei den Ereignissen entstünden nicht selten kombinierte Persönlichkeitsstörungen mit vorwiegend emotional-instabilen und antisozialen Wesensrichtungen, für die sich auch bei der Klägerin Anhalte fänden. Es zeigten sich Hinweise auf verantwortungsloses Verhalten, Delinquenz, geringe Frustrationstoleranz, Rationalisierungen für das eigene Verhalten und die Beschuldigung von anderen. Eine mittelgradige Persönlichkeitsstörung werde indessen nicht erreicht. Gedanklich müsse insbesondere eine substanzbezogene Störung in Abzug gebracht werden. Der Schweregrad einer Persönlichkeitsstörung vor dem Hintergrund einer Abhängigkeitserkrankung könne nur geschätzt werden.
Eine Angststörung bestehe nicht. Es sei eine Panikattacke berichtet worden, die Plausibilität reiche nicht für die Diagnose einer Angststörung aus. Der Substanzkonsum sei hier konkurrierende Ursache von körperlichen Erkrankungen. Eine Essstörung könne bestehen, was sich nicht ausreichend aufklären lasse.
Die weitere Prognose sei nicht vollständig ungünstig. An der Persönlichkeitsstörung solle psychotherapeutisch gearbeitet werden, eine Entgiftung und Entwöhnung seien erneut notwendig. Willentlich bestehe keine vollständige Steuerbarkeit der Abhängigkeit und Persönlichkeitsstörung.
Eine PTBS sei nicht erwiesen, wenn eine solche indessen einmal bestanden habe, hätten die Ereignisse nur eine untergeordnete Rolle gespielt, da es sich um einen Milieufall handele, in dem von einer Vielzahl von belastenden Ereignissen und Problemen im Umfeld auszugehen sei. Dies werde durch die aktenkundigen möglichen Straftaten, durch die fortgesetzten Probleme im Umfeld, durch den Drogenkonsum, die Natur der Tätigkeiten und letztlich die Biographie angezeigt.
Der Substanzkonsum habe bereits die Jugend geprägt, der Prostitution sei wenigstens ab dem 18. Lebensjahr nachgegangen worden. Ein Umfeld mit Drogenverkauf im Umfeld, Feiern auf der R2 und in Diskotheken wie Besitz eines Internetcafes seien berichtet worden. Gleichzeitig werde die Fürsorge für die Familie (Großeinkauf), für die Geschwister seit der jüngeren Kindheit berichtet und der Kontakt zu Mutter und Stiefvater sei fortgesetzt worden. Es könne daher nicht von Ereignissen ausgegangen werden, die damals schon und bis heute als einzige Ursache schwere Symptome erzeugt hätten, die allein so prägend gewesen seien.
Natürlich seien es schwere Ereignisse, sexuelle Übergriffe und Gewalt dürften nicht relativiert werden. Andererseits werde selbst bei schweren sexuellen Übergriffen nicht automatisch mit posttraumatischen Symptomen reagiert. Bei einer Vergewaltigung sei die Rate für eine PTBS in der Nähe von 50 % angesiedelt, nicht etwa bei 99 %.
Es sei nicht auszuschließen, dass eine multifaktorielle psychische Störung mit wiederkehrender Depression, Substanzabhängigkeit und kombinierter Persönlichkeitsstörung nicht schon 2017 vorgelegen habe und im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten dann die schädigenden Ereignisse als Hauptursache angeschuldigt worden seien. Bei der Biographie und den bekannten Faktoren sei es sogar wahrscheinlich, dass eine wiederkehrende Depression und Persönlichkeitsstörung vor 2017 vorgelegen haben.
Zur Frage der Teilursächlichkeit könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich eine andere Biographie entwickelt hätte, wenn man die sexuellen Übergriffe gedanklich in Abzug bringe. Da das Umfeld sehr problematisch gewesen sei, hätte sich mit ganz erheblicher Wahrscheinlichkeit auch bei einem solchen Umfeld eine Persönlichkeitsstörung und wiederkehrende Depression sowie Substanzabhängigkeit entwickeln können.
Behelfsmäßig würden die traumatisierenden Ereignisse als mitursächlich eingestuft und der Anteil dieser Ereignisse an der späteren Aufrechterhaltung und Entwicklung von Sucht, von Persönlichkeitsstörung und Phasen der Depression als deutlich nachrangig eingestuft, mit einem Anteil von 25 %. Andere Faktoren seien deutlich maßgeblicher, insbesondere im Verlauf.
Bei der Klägerin sei vom Vorliegen mittelgradiger sozialer Anpassungsschwierigkeiten trotz des Berichts über langjährige Verbindungen mit Wahrscheinlichkeit auszugehen. Probleme in zahlreichen Beziehungen mit anderen Menschen würden aus der Akte deutlich. Dies sei auch dann so, wenn sie oft einen regelrechten Alltag berichte, die häufigen zwischenmenschlichen, auch beruflichen wie privaten Probleme erfüllten den Tatbestand mit hoher Wahrscheinlichkeit, trotz der negativen Verzerrung. Diese Verzerrung schmälere die diagnostische Sicherheit.
Es spreche mehr dafür als dagegen, dass ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 für die psychische Störung mit Abhängigkeit adäquat sei. Ergebe sich eine geringe Teilursache des GdB 50, sei zu empfehlen, den GdS für den Anteil an einer psychischen Störung mit Abhängigkeit von multiplen Substanzen, wiederkehrender Depression und Persönlichkeitsstörung mit 20 einzustufen.
Das Gutachten des L1 genüge den allgemeinen Maßstäben an ein Gutachten nicht. Sekundäre Faktoren würden nicht ausreichend evaluiert, Prüfung von Plausibilität und Konsistenz keine vorgenommen. Insbesondere werde die Frage der Plausibilität einer fortgesetzten Vollbild-Symptomatik einer PTBS nicht diskutiert, eine solche würde ja bei einem GdS von 30 als Durchschnittsbildung vorausgesetzt. Wenn sich L1 bei der Frage einer Substanzabhängigkeit auf die Angaben verlasse, sei das nicht sachgerecht, da Dissimulation bei Substanzabhängigkeiten häufig sei. Die Frage einer Persönlichkeitsstörung werde nicht ausreichend diskutiert, es reiche nicht aus, wenn die Klägerin andere Belastungsfaktoren verneine. Das Gutachten sei nicht geeignet, die Kausalität oder die Höhe des GdS fachgerecht zu untermauern.
Der GdS sei auf 20 einzuschätzen, Leistungen zur Rehabilitation brauche es nach Entgiftung für die Abstinenz, im Schwerpunkt aber schädigungsunabhängig.
Das Sachverständigengutachten ist der Klägerin mit Verfügung vom 21. November 2024 übersandt worden, nach mehrfachen Erinnerungen ist eine Fristverlängerung beantragt und ein Antrag nach § 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) angekündigt worden. Mit Verfügung vom 27. Dezember 2024 hat das SG eine Frist zur Antragstellung nach § 109 SGG bis 30. Januar 2025 gesetzt.
Nachdem eine Antragstellung nicht erfolgt ist, hat das SG mit Verfügung vom 3. Februar 2025 eine Rücknahme der Klage angeregt und eine Entscheidung durch Gerichtsbescheid angekündigt.
Mit Schriftsatz vom 3. Februar 2025 hat die Klägerin Einwände gegen das Sachverständigengutachten geltend gemacht. Sie habe Escitalopram erst am Freitag vor der Begutachtung am Montag abgesetzt. Sie habe nicht angegeben, dass das Arbeitsverhältnis wegen der Depression gekündigt worden sei, sondern wegen der Fehltage und ihrer Konzentrationsschwäche. Sie selbst, nicht die Therapeutin, habe entschieden, nicht nach H1 zu fahren, wegen der ganzen Dinge, die sie triggerten. H1 sei für sie die „Konsumstadt“ gewesen.
Die Leistungseinschätzung der Rehablitationsklinik 2021 habe auf ihrer Eigeneinschätzung beruht. Sie habe am Ende der Therapie gedacht, dass sie Bäume ausreißen könne. Tatsächlich habe sie dann aber festgestellt, dass außerhalb des geschützten Rahmens der Klinik die Welt doch anders aussehe. Sie habe nicht eine Traumatherapie hintangestellt, um ihre Mutter zu pflegen. Sie wisse allerdings, dass sie ihre Großmutter gepflegt habe und in diesem Zusammenhang eine Therapie hintangestellt worden sein könne. Soweit der Sachverständige davon ausgehe, dass langjährige Sozialkontakte bestünden, sei zu bemerken, dass diese Kontakte vorlägen, aber von ihr nicht beständig gepflegt werden könnten. Ihre Ausbildung habe sie nicht erfolgreich absolviert, sondern mit „Ach und Krach“ mit einem Befriedigend bestanden. Im Hinblick auf die Vielzahl der Missverständnisse sei das Gutachten insgesamt nicht geeignet, es sei ein neues Gutachten einzuholen.
Der Sachverständige bestätige die Diagnose einer PTBS nicht, obwohl nach dem ITQ-Test eine solche Störung vorliege. Die Frage nach der Höhe des GdS werde mit 20 als Anteil eines GdB von 50 beantwortet. Dass die rechtskräftig festgestellten Vorgänge zwischen 1991 und 2000 lediglich untergeordnet teilursächlich, im Übrigen aber milieubedingt sein sollten, sei nicht nachvollziehbar, obwohl offenbar auch nach Ansicht des Sachverständigen es sich bei den Vorgängen um solche mit überragender Bedeutung handele. Dass das Umfeld Einfluss auf die Persönlichkeitsstörung habe, werde lediglich mit erheblicher Wahrscheinlichkeit angenommen. Trotz dieser Ungewissheit würden die rechtskräftig festgestellten Vorgänge nur mit einer Teilursächlichkeit von 25 % bewerten, was nicht nachvollziehbar sei. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass ohne die sexuellen Übergriffe davon auszugehen sei, dass der Krankheitsverlauf diese oder eine ähnliche Entwicklung genommen habe. Es gebe keinen Automatismus dafür, dass Kinder, die in dem „Milieu“ aufgewachsen seien, zwangsläufig Persönlichkeitsstörungen entwickelten. Ohne diese sexuellen Übergriffe wäre es nicht zu den Erkrankungen gekommen, sodass auch nach dem Sachverständigengutachten ein GdS von 50 belegt sei.
Das SG hat an der beabsichtigen Entscheidung festgehalten und zur Benennung eines Sachverständigen nach § 109 SGG nochmals eine Frist bis 3. März 2025 gesetzt, deren weitere Verlängerung abgelehnt worden ist.
Mit Gerichtsbescheid vom 20. März 2025 hat das SG die Klage abgewiesen. Ein Anspruch auf höhere Beschädigtengrundrente ergebe sich aufgrund des eingeholten Sachverständigengutachtens nicht. Eine höhere Beschädigtengrundrente auch unter Berücksichtigung eines Berufsschadensausgleichs komme nicht in Betracht, da dem jedenfalls die Sperrwirkung des § 29 BVG entgegenstehe und der Sachverständige nachvollziehbar ausgeführt habe, dass Leistungen zur Rehabilitation nach Entgiftung für die Abstinenz, wenngleich schädigungsunabhängig, benötigt würden. Eine Ausgleichsrente nach § 32 RVG komme schon deswegen nicht in Betracht, da die Klägerin nicht schädigungsbedingt schwerbeschädigt sei.
Am 22. April 2025 hat die Klägerin Berufung beim Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) eingelegt. Es sei dargelegt worden, dass in acht Punkten die zitierten Äußerungen des Sachverständigen G1 nicht richtig wiedergegeben worden seien und dass Widersprüche in dem Sachverständigengutachten bestünden, sodass dieses keine Verwendung als Entscheidungsgrundlage finden könne. Der Sachverständige lehne eine PTBS ab, obwohl eine solche nach dem entsprechenden Test vorliege. Dieser Widerspruch sei weder im Sachverständigengutachten noch im Gerichtsbescheid beachtet. Die vom Sachverständigen genannten weiteren Faktoren wie Drogenkonsum, Prostitution, Delinquenz und Probleme in der Beziehung seien Folgen der PTBS, was der Sachverständige nicht diskutiere. Insbesondere werde nicht erörtert, dass diese als selbstständig deklarierte Faktoren typische Folgen einer anderweitig erfolgten Traumatisierung seien.
Die Klägerin beantragt,
den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Heilbronn vom 20. März 2025 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen, ihr unter Abänderung des Bescheides vom 24. Oktober 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14. Juni 2023 höhere Beschädigtengrundrente nach einem GdS von wenigstens 50 sowie Berufsschadensausgleich und Ausgleichsrente zu gewähren.
Der Beklagte beantragt,
die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.
Er verweist auf die angefochtene Entscheidung.
Der Senat hat mit Verfügung vom 28. Mai 2025 darauf hingewiesen, dass weiterer Ermittlungsbedarf nicht gesehen werde und hat mit Verfügung vom 10. September 2025 Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 4. Dezember 2025 bestimmt. Mit Schriftsatz vom 7. November 2025 hat die Klägerin die Einholung eines Sachverständigengutachtens nach § 109 SGG bei dem „M3 M4, V1, R3“ beantragt.
Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Verwaltungs- und Gerichtsakte Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Der Senat konnte verhandeln und entscheiden, obwohl für die Klägerin niemand zum Termin zur mündlichen Verhandlung erschienen ist, da mit der dem Klägervertreter am 11. September 2025 ordnungsgemäß zugestellten Ladung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist (§ 110 Abs. 1 Satz 2 SGG).
Die form- und fristgerecht (§ 151 SGG) eingelegte Berufung der Klägerin ist statthaft (§§ 143, 144 SGG) und auch im Übrigen zulässig, aber unbegründet.
Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist der Gerichtsbescheid des SG vom 20. März 2025, mit dem die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (§ 54 Abs. 1 und 4 SGG) auf höhere und weitere Beschädigtenversorgung unter Abänderung des Bescheides vom 24. Oktober 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides (§ 95 SGG) vom 14. Juni 2023 abgewiesen worden ist. Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist bei dieser Klageart grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen (vgl. BSG, Urteil vom 2. September 2009 – B 6 KA 34/08 –, juris, Rz. 26; Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, Kommentar zum SGG, 14. Aufl. 2023, § 54 Rz. 34), ohne eine solche derjenige der Entscheidung.
Die Unbegründetheit der Berufung folgt aus der Unbegründetheit der Klage. Der Bescheid vom 24. Oktober 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14. Juni 2023 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 54 Abs. 2 Satz 1 SGG). Auch zur Überzeugung des Senats hat der Beklagte die Beschädigtengrundrente nicht rechtswidrig zu niedrig festgestellt und zu Recht weder eine Erhöhung wegen besonderer beruflicher Betroffenheit vorgenommen, noch einen Berufsschadensausgleich gewährt. Die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Ausgleichsrente liegen schon deshalb nicht vor, da bei der Klägerin kein GdS von wenigstens 50 besteht. Die Abweisung der Klage ist daher nicht zu beanstanden.
Materiell-rechtlich sind die Vorschriften des BVG in seiner bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung anzuwenden. Gemäß § 142 Abs. 1 Satz 1 Vierzehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XIV) in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung erhalten Personen, deren Ansprüche nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das das Bundesversorgungsgesetz ganz oder teilweise für anwendbar erklärt, in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2023 bestandskräftig festgestellt sind, diese Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach dem Gesetz, das das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklärt, in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter, soweit dieses Kapitel nichts anderes bestimmt. Über einen bis zum 31. Dezember 2023 gestellten und nicht bestandskräftig entschiedenen Antrag auf Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das das Bundesversorgungsgesetz ganz oder teilweise für anwendbar erklärt, ist nach dem im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Recht zu entscheiden, § 142 Abs. 2 Satz 1 SGB XIV. Wird hierbei ein Anspruch auf Leistungen festgestellt, werden ebenfalls Leistungen nach Absatz 1 erbracht, § 142 Abs. 2 Satz 2 SGB XIV.
Rechtsgrundlage für den geltend gemachten Anspruch ist § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 1, § 30, § 31 BVG. Danach erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des BVG, unter anderem auch Beschädigtengrundrente nach § 31 Abs. 1 BVG, wer im Geltungsbereich des OEG oder auf einem deutschen Schiff oder Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Versorgung umfasst nach dem insoweit entsprechend anwendbaren § 9 Abs. 1 Nr. 3 BVG die Beschädigtenrente (§§ 29 ff. BVG). Nach § 30 Abs. 1 Satz 1 BVG ist der GdS - bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des BVG und anderer Vorschriften des Sozialen Entschädigungsrechts vom 13. Dezember 2007 (BGBl I S. 2904) am 21. Dezember 2007 als Minderung der Erwerbsfähigkeit <MdE> bezeichnet - nach den allgemeinen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen, welche durch die als Schädigungsfolge anerkannten körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheitsstörungen bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Der GdS ist nach Zehnergraden von 10 bis 100 zu bemessen; ein bis zu fünf Grad geringerer GdS wird vom höheren Zehnergrad mit umfasst (§ 30 Abs. 1 Satz 2 BVG). Beschädigte erhalten gemäß § 31 Abs. 1 BVG eine monatliche Grundrente ab einem GdS von 30. Liegt der GdS unter 25 besteht kein Anspruch auf eine Rentenentschädigung (vgl. Senatsurteil vom 18. Dezember 2014 - L 6 VS 413/13 -, juris, Rz. 42; Dau, in: Knickrehm, Gesamtes Soziales Entschädigungsrecht, 2012, § 31 BVG, Rz. 2).
Für einen Anspruch auf Beschädigtenversorgung nach dem OEG in Verbindung mit dem BVG sind folgende rechtlichen Grundsätze maßgebend (vgl. BSG, Urteil vom 17. April 2013 – B 9 V 1/12 R –, BSGE 113, 205 <208 ff.>):
Ein Versorgungsanspruch setzt zunächst voraus, dass die allgemeinen Tatbestandsmerkmale des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG gegeben sind (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 23. April 2009 – B 9 VG 1/08 R –, juris, Rz. 27 m. w. N). Danach erhält eine natürliche Person („wer“), die im Geltungsbereich des OEG durch einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des BVG. Somit besteht der Tatbestand des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG aus drei Gliedern (tätlicher Angriff, Schädigung und Schädigungsfolgen), die durch einen Ursachenzusammenhang miteinander verbunden sind. In Altfällen, also bei Schädigungen zwischen dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 und dem Inkrafttreten des OEG am 16. Mai 1976 (BGBl I S. 1181), müssen daneben noch die besonderen Voraussetzungen gemäß § 10 Satz 2 OEG in Verbindung mit § 10a Abs. 1 Satz 1 OEG erfüllt sein. Nach dieser Härteregelung erhalten Personen, die in diesem Zeitraum geschädigt worden sind, auf Antrag Versorgung, solange sie allein infolge dieser Schädigung schwerbeschädigt und bedürftig sind sowie im Geltungsbereich des OEG ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Eine Schwerbeschädigung liegt nach § 31 Abs. 2 BVG vor, wenn ein GdS von mindestens 50 festgestellt ist.
Nach der Rechtsprechung des BSG ist bei der Auslegung des Rechtsbegriffes „vorsätzlicher, rechtswidriger tätlicher Angriff“ im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG entscheidend auf die Rechtsfeindlichkeit, vor allem verstanden als Feindlichkeit gegen das Strafgesetz, abzustellen; von subjektiven Merkmalen, wie etwa einer kämpferischen, feindseligen Absicht, hat sich die Auslegung insoweit weitestgehend gelöst (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 7. April 2011 – B 9 VG 2/10 R –, SozR 4-3800 § 1 Nr. 18, Rz. 32 m. w. N.). Dabei sind je nach Fallkonstellation unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und verschiedene Gesichtspunkte hervorgehoben worden. Leitlinie ist insoweit der sich aus dem Sinn und Zweck des OEG ergebende Gedanke des Opferschutzes. Das Vorliegen eines tätlichen Angriffes hat das BSG daher aus der Sicht von objektiven, vernünftigen Dritten beurteilt und insbesondere sozial angemessenes Verhalten ausgeschieden. Allgemein ist es in seiner bisherigen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass als tätlicher Angriff grundsätzlich eine in feindseliger oder rechtsfeindlicher Willensrichtung unmittelbar auf den Körper eines anderen zielende gewaltsame Einwirkung anzusehen ist, wobei die Angriffshandlung in aller Regel den Tatbestand einer - jedenfalls versuchten - vorsätzlichen Straftat gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit erfüllt (st. Rspr.; vgl. nur BSG, Urteil vom 29. April 2010 – B 9 VG 1/09 R –, SozR 4-3800 § 1 Nr. 17, Rz. 25 m. w. N.). Abweichend von dem im Strafrecht umstrittenen Gewaltbegriff im Sinne des § 240 Strafgesetzbuch (StGB) zeichnet sich der tätliche Angriff im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG durch eine körperliche Gewaltanwendung (Tätlichkeit) gegen eine Person aus, wirkt also körperlich (physisch) auf einen anderen ein (vgl. BSG, Urteil vom 7. April 2011 ‑ B 9 VG 2/10 R ‑, SozR 4 3800 § 1 Nr. 18, Rz. 36 m. w. N.). Ein solcher Angriff setzt eine unmittelbar auf den Körper einer anderen Person zielende, gewaltsame physische Einwirkung voraus; die bloße Drohung mit einer wenn auch erheblichen Gewaltanwendung oder Schädigung reicht hierfür demgegenüber nicht aus (vgl. BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 ‑ B 9 V 1/13 R ‑, juris, Rz. 23 ff.).
In Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Sinne von § 176, § 176a StGB hat das BSG den Begriff des tätlichen Angriffes noch weiter verstanden. Danach kommt es nicht darauf an, welche innere Einstellung der Täter zu dem Opfer hatte und wie das Opfer die Tat empfunden hat. Es ist allein entscheidend, dass die Begehensweise, also eine sexuelle Handlung, eine Straftat war (vgl. BSG, Urteil vom 29. April 2010 ‑ B 9 VG 1/09 R ‑, SozR 4 3800 § 1 Nr. 17, Rz. 28 m. w. N.). Auch der „gewaltlose“ sexuelle Missbrauch eines Kindes kann demnach ein tätlicher Angriff im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG sein (BSG, Urteile vom 18. Oktober 1995 - 9 RVg 4/93 -, BSGE 77, 7, <8 f.> und - 9 RVg 7/93 -, BSGE 77, 11 <13>). Diese erweiternde Auslegung des Begriffes des tätlichen Angriffs ist speziell in Fällen eines sexuellen Missbrauchs von Kindern aus Gründen des sozialen und psychischen Schutzes der Opfer unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des OEG geboten.
Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Tatsachen kennen das Soziale Entschädigungsrecht und damit auch das OEG drei Beweismaßstäbe. Grundsätzlich bedürfen die drei Glieder der Kausalkette (schädigender Vorgang, Schädigung und Schädigungsfolgen) des Vollbeweises. Für die Kausalität selbst genügt gemäß § 1 Abs. 3 BVG die Wahrscheinlichkeit. Nach Maßgabe des § 15 Satz 1 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung (KOVVfG), der gemäß § 6 Abs. 3 OEG anzuwenden ist, sind bei der Entscheidung die Angaben der Antragstellenden, die sich auf die mit der Schädigung, also insbesondere auch mit dem tätlichen Angriff im Zusammenhang stehenden Tatsachen beziehen, zugrunde zu legen, wenn sie nach den Umständen des Falles glaubhaft erscheinen.
Für den Vollbeweis muss sich das Gericht die volle Überzeugung vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Tatsache verschaffen. Allerdings verlangt auch der Vollbeweis keine absolute Gewissheit, sondern lässt eine an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit ausreichen. Denn ein darüber hinausgehender Grad an Gewissheit ist so gut wie nie zu erlangen (vgl. Keller, a. a. O., § 128 Rz. 3b m. w. N.). Daraus folgt, dass auch dem Vollbeweis gewisse Zweifel innewohnen können, verbleibende Restzweifel mit anderen Worten bei der Überzeugungsbildung unschädlich sind, solange sie sich nicht zu gewichtigen Zweifeln verdichten (vgl. BSG, Urteil vom 24. November 2010 - B 11 AL 35/09 R -, juris, Rz. 21). Eine Tatsache ist bewiesen, wenn sie in so hohem Grade wahrscheinlich ist, dass alle Umstände des Falles nach vernünftiger Abwägung des Gesamtergebnisses des Verfahrens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sind, die volle richterliche Überzeugung zu begründen (vgl. Keller, a. a. O.).
Der Beweisgrad der Wahrscheinlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BVG ist dann gegeben, wenn nach der geltenden wissenschaftlichen Lehrmeinung mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht (vgl. BSG, Beschluss vom 8. August 2001 – B 9 V 23/01 B –, SozR 3-3900 § 15 Nr. 4, S. 14 m. w. N.). Diese Definition ist der Fragestellung nach dem wesentlichen ursächlichen Zusammenhang (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 - B 9 V 6/13 R -, juris, Rz. 18 ff.) angepasst, die nur entweder mit ja oder mit nein beantwortet werden kann. Es muss sich unter Würdigung des Beweisergebnisses ein solcher Grad von Wahrscheinlichkeit ergeben, dass ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen Möglichkeit ausscheiden. Für die Wahrscheinlichkeit ist ein „deutliches" Übergewicht für eine der Möglichkeiten erforderlich. Sie entfällt, wenn eine andere Möglichkeit ebenfalls ernstlich in Betracht kommt.
Bei dem „Glaubhafterscheinen“ im Sinne des § 15 Satz 1 KOVVfG handelt es sich um den dritten, mildesten Beweismaßstab des Sozialrechts. Glaubhaftmachung bedeutet das Dartun einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl. Keller, a. a. O., Rz. 3d m. w. N.), also der guten Möglichkeit, dass sich der Vorgang so zugetragen hat, wobei durchaus gewisse Zweifel bestehen bleiben können (vgl. BSG, Beschluss vom 8. August 2001 - B 9 V 23/01 B -, SozR 3 3900 § 15 Nr. 4, S. 14 f. m. w. N.). Dieser Beweismaßstab ist durch seine Relativität gekennzeichnet. Es muss nicht, wie bei der Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhanges, absolut mehr für als gegen die glaubhaft zu machende Tatsache sprechen. Es reicht die gute Möglichkeit aus, also es genügt, wenn bei mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden Möglichkeiten das Vorliegen einer davon relativ am wahrscheinlichsten ist (vgl. Keller, a. a. O.), weil nach der Gesamtwürdigung aller Umstände besonders viel für diese Möglichkeit spricht. Von mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden Sachverhaltsvarianten muss einer den übrigen gegenüber ein gewisses, aber kein deutliches Übergewicht zukommen. Wie bei den beiden anderen Beweismaßstäben reicht die bloße Möglichkeit einer Tatsache nicht aus, um die Beweisanforderungen zu erfüllen. Das Tatsachengericht ist allerdings mit Blick auf die Freiheit der richterlichen Beweiswürdigung (§ 128 Abs. 1 Satz 1 SGG) im Einzelfall grundsätzlich darin nicht eingeengt, ob es die Beweisanforderungen als erfüllt ansieht (vgl. BSG, Beschluss vom 8. August 2001 ‑ B 9 V 23/01 B ‑, SozR 3-3900 § 15 Nr. 4, S. 15). Diese Grundsätze haben ihren Niederschlag auch in den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im Sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz“ in ihrer am 1. Oktober 1998 geltenden Fassung der Ausgabe 1996 (AHP 1996) und nachfolgend - seit Juli 2004 - den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im Sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX)“ in ihrer jeweils geltenden Fassung (AHP 2005 und 2008) gefunden, welche zum 1. Januar 2009 durch die Anlage zu § 2 Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) vom 10. Dezember 2008 (Teil C, Nrn. 1 bis 3 und 12 der Anlage zu § 2 VersMedV; vgl. BR-Drucks 767/1/08 S. 3, 4) inhaltsgleich ersetzt worden ist (vgl. BSG, Urteil vom 16. Dezember 2014 ‑ B 9 V 6/13 R ‑, juris, Rz. 17).
Der Beklagte hat mit dem Bescheid vom 24. Oktober 2019 – für den Senat bindend – festgestellt, dass die Klägerin zwischen 1991 und 2000 Opfer fortgesetzter, rechtswidriger tätlicher Angriffe geworden ist, hat eine „Posttraumatische Belastungsstörung“ als Schädigungsfolge anerkannt und Beschädigtengrundrente nach einem GdS von 30 gewährt. Nach den oben aufgezeigten Maßstäben sind damit die unstreitig feststehenden sexuellen Übergriffe im Kindes- und Jugendlichenalter zum Nachteil der Klägerin berücksichtigt und gewürdigt worden, da diese nach der Rechtsprechung des BSG jedenfalls tätlichen Angriffen gleichzustellen sind.
Anhand der aktenkundigen Unterlagen, die der Senat im Wege des Urkundsbeweises verwertet (§ 118 Abs. 1 SGG i. V. m. §§ 415 ff. Zivilprozessordnung [ZPO]), sowie des Sachverständigengutachtens des G1 ist zur Überzeugung des Senats seit der Antragstellung im Mai 2015 (vgl. zum Leistungsbeginn auch § 60 BVG) indessen weder das Vollbild einer PTBS gesichert, noch weitere schädigungsbedingte Gesundheitsstörungen, die bei der Bewertung des GdS oder für weitergehende Ansprüche zu berücksichtigen wären.
In Rechnung zu stellen ist dabei zunächst, dass nur die sexuellen Übergriffe einen entschädigungsrelevanten Sachverhalt darstellen, nicht aber die von der Klägerin behauptete „emotionale Vernachlässigung“ und das Vorbringen, dass sie den Haushalt und ihre Geschwister habe versorgen müssen. Der Umstand, dass die Klägerin sicherlich in desolaten Familienverhältnissen aufgewachsen ist, erweist sich daher nicht als bewertungsrelevant. Dies verkennt der Gutachter L1, wenn er die „familiäre Situation“ in Ursache und Wirkung mit dem sexuellen Missbrauch gleichstellt und hieraus Schlussfolgerungen zieht. Er geht damit von unzutreffenden Anknüpfungstatsachen aus und unterlässt die notwendigen Abgrenzungen unter Kausalitätsgesichtspunkten, was nicht überzeugen kann. Auf diese Mängel des Gutachtens hat der Sachverständige G1 zu Recht hingewiesen und diese hätten bereits bei der versorgungsärztlichen Prüfung auffallen müssen.
Diese nicht entschädigungsrelevanten Umständen werden indessen von der Klägerin selbst immer wieder in den Vordergrund gerückt und als Ursache ihrer angegebenen Funktionseinschränkungen gesehen. So hat sie schon bei der Behandlung im Z1 W1 2020 in erster Linie über die emotionale Vernachlässigung durch die Mutter berichtet. Gegenüber G1 ist angegeben worden, dass ihr durch die Begutachtung bei L1 bewusst geworden ist, was es ausmacht, emotional vernachlässigt worden zu sein, was für sie schlimmer ist, als die sexuellen Taten (vgl. auch die Angaben in der Rehabilitationsklinik L2). Durch diese Erkenntnis soll es zu einer Verschlechterung des Zustandsbildes gekommen sein, also gerade nicht aufgrund der hier einzig relevanten tätlichen Angriffe.
Ohnehin geht die Klägerin fehl in der Annahme, aus der behaupteten Verschlechterung nach der Untersuchung bei L1 weitergehende Ansprüche herleiten zu können. Es stellt nämlich einen Zirkelschluss dar, wenn sie meint, dass allein wegen ihrer behaupteten Reaktion auf die Ermittlungstätigkeit des Beklagten schon höhergradige Funktionseinschränkungen der Bewertung zu Grunde zu legen sind. Die Ermittlungstätigkeit für sich begründet per se nämlich gerade kein schädigendes Ereignis. In diesem Sinne hat G1 aus fachlicher Sicht ebenfalls ausgeführt, dass durch eine Begutachtung im Einzelfall zwar eine vorübergehende Verstärkung der Belastung eingetreten kann. Hierbei handelt es sich, so G1 weiter, indessen weder um eine dauerhafte Verschlechterung, noch um eine Retraumatisierung, wie die Klägerin glauben machen will und was von den Behandlern unkritisch – und damit zu Unrecht – in die Behandlungsberichte übernommen worden ist. Im Übrigen kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass L1 ausdrücklich vermerkt hat, dass am Ende der Untersuchung eine ausreichende Stabilität für die Rückreise bestanden hat, was schwerwiegende Beeinträchtigungen aus der Untersuchungssituation heraus gerade widerlegt.
Hinsichtlich der PTBS hat der G1 für den Senat überzeugend herausgearbeitet, dass weder das bei seiner Untersuchung zu sichernde klinische Bild noch die Verlaufsbetrachtung eine klinische relevante PTBS-Symptomatik belegen.
Der Sachverständige hat dargelegt, dass tägliche Albträume und Flashbacks bei lange zurückliegenden Traumen nicht wahrscheinlich sind und es im Verlauf unplausibel ist, wenn über weite Strecken eine remittierte Symptomatik beschrieben ist, die nunmehr wieder eine Verstärkung erfahren haben soll. Passend hierzu waren die Angaben der Klägerin zu den Albträumen und Flashbacks – aus der fachlichen Sicht des Sachverständigen – nicht plastisch, sondern ausweichend und oberflächlich. Soweit die Nachfragen des Sachverständigen im Rahmen seiner sorgfältigen Anamneseerhebung zu den Albträumen ergeben haben, dass Inhalt der Bilder die familiäre Situation in der Kindheit gewesen sein soll, bezogen sich diese somit auf nicht entschädigungsrelevante Umstände. Dies zeigte sich zuvor schon im Z1 W1, wo auch nur von unspezifischen traumatischen Erlebnissen in der Kindheit berichtet worden ist. Nachvollziehbar legt der Sachverständige deshalb dar, dass die Angabe von Flashbacks und Albträumen nicht unkritisch in die Diagnose – konkret einer PTBS – übersetzt werden darf und dass statistisch gesehen selbst auf schwere sexuelle Übergriffe nur in 50 % der Fälle mit einer PTBS reagiert wird. Aus der Schwere der Ereignisse allein kann daher nicht zwingend auf eine PTBS geschlossen werden, wie der Fall der Klägerin belegt, sodass es nicht ausreicht, dass durch das strafrechtliche Verfahren Umstände gesichert werden konnten, die – so auch zutreffend G1 – das Eingangskriterium der PTBS erfüllen.
Zum Verlauf hat G1 schlüssig herausgestellt, dass die einmalige Behandlung durch eine Psychotherapeutin 2009 keine belastbare Grundlage für die Annahme von Brückensymptomen bietet und sich somit deutlich zeigt, dass die Behandlung sowie die behauptete Beschwerdezunahme im deutlichen zeitlichen Kontext zu der Anzeigeerstattung stehen. Die fachliche Auswertung der Verlaufsberichte der PIA durch G1 hat ergeben, dass aus diesen keine klinisch relevante PTBS-Symptomatik folgt, nachdem dort Flashbacks und Albträume ausdrücklich verneint werden. Dass die PIA dennoch durchgehend dieselben Diagnosen – nämlich PTBS und schwere depressive Episode – benennt, führt deshalb nicht weiter, da diese Diagnosen gerade nicht durch klinische Befunde gestützt werden, wie G1 betont.
Ein relevantes Vermeidungsverhalten verneint G1 weiter schlüssig deshalb, weil die Klägerin eine Tätigkeit im Bereich der Sexarbeit verrichtet hat und keine Vermeidung etwa von Orten in H1 besteht. Tatsache ist nämlich, dass die Klägerin selbst über eine Aufrechterhaltung von Bindungen in Bezug auf ihre Geschwister und ihre beste Freundin berichtet hat, wobei der Sachverständige nachvollziehbar die langjährigen Sozialkontakte als Ausdruck einer nicht nur geringen sozialen Anpassungsfähigkeit wertet. Passend hierzu ergibt sich aus der Akte, dass die Klägerin im Strafverfahren gegen die Mutter mehrfach hat vernommen werden können und bei diesen Vernehmungen umfangreiche Angaben gemacht hat, sich mit den Vorkommnissen folglich hat befassen können, was auch Ausdruck einer Verarbeitung der Geschehnisse ist. Bei der Untersuchung durch G1 hat sich ebenfalls keine emotionale Beteiligung bei der Klägerin, weder beim Thema Symptome, noch bei den traumatisierenden Ereignissen, gezeigt.
Daneben sieht der Sachverständige zu Recht deshalb eine Inkonsistenz im Vorbringen der Klägerin, weil diese trotz angeblich bestehender gleichbleibender Symptome einer PTBS bereits seit 2014 in einer stabilen Beziehung gelebt und bis zur Geburt der Tochter eine erfüllte Sexualität erlebt hat, somit eine Situation ohne relevante Störungen und zwar weder im sozialen Bereich noch im Bereich der Nähe bestanden hat. Dass Einschränkungen hinsichtlich der Sexualität auch gegenwärtig nicht bestehen, hat die Klägerin gegenüber dem Sachverständigen bestätigt. Sie will nur keine enge partnerschaftliche Beziehung mehr führen, was nicht schädigungsbedingt ist.
Das Vorbringen der Klägerin gegenüber dem Sachverständigen vermag daneben in tatsächlicher Hinsicht nicht zu überzeugen. Wenn die finanziellen Verhältnisse der Familie so beengt gewesen sind, dass die Kinder quasi an die Kunden der Mutter verkauft werden mussten (vgl. insbesondere die Schilderungen der Klägerin gegenüber L1), ist es unschlüssig, wenn die Klägerin behauptet, von den Eltern nach dem Auszug finanziell unterstützt worden zu sein und keine finanziellen Probleme gehabt zu haben. Ebenso erschließt sich deren Vortrag, dass sie nach ihrem Auszug einmal wöchentlich einen Großeinkauf für die Familie erledigt habe, also Kontakt zur Familie hatte, obwohl sie von der Mutter aus der Wohnung geworfen worden sein will, genauso wenig, wie das jetzige Vorbringen, wonach sie von den Eltern gequält worden sein will, nachdem sie bislang immer davon berichtet hat, dass der Stiefvater bemüht gewesen ist, die Familie zusammenzuhalten. Es zeigt sich somit eine erhebliche Ausweitung des Vorbringens, was gegen einen Erlebnisbezug spricht.
Die Einwände gegen das Sachverständigengutachten überzeugen nicht, da sie einerseits erst mit einer deutlichen zeitlichen Latenz nach der Begutachtung überhaupt vorgebracht worden sind, andererseits aber auch in der Sache nicht durchgreifen. Hinsichtlich der Einnahme von Escitalopram hat G1 gerade nicht nur den aktuellen Spiegel, sondern daneben die Abbauprodukte bestimmt und ausgeführt, dass solche ebenfalls nicht nachzuweisen waren, was gegen ein erst kurzfristiges Absetzen spricht. Aus fachlicher Sicht hat er hierzu weiter dargelegt, dass der behauptete Zweck der Medikation mit einem Absetzen gerade vor der vermeintlich belastenden Gutachtensituation nicht nachvollziehbar ist und ein solches Vorgehen eine Abhängigkeit der Therapie vom Gutachtenskontext belegen würde, aber keine medizinische Indikation.
Aus welchen Gründen das Arbeitsverhältnis gekündigt worden sein mag, ist für die Beurteilung des Sachverständigen schon gar nicht relevant geworden. Der Sachverständige hat indessen notiert, dass die Klägerin angegeben hat, dass die Depression in der Kündigung nicht genannt worden sei, der Klägerin die Kündigung aber wegen ihres bevorstehenden Umzugs recht gewesen ist, worauf sie schon gar nicht eingeht. Dass die Kündigung wegen einer Depression erfolgt ist, hat die Klägerin lediglich gegenüber L1 angegeben. Ob die Therapeutin ihr geraten hat, nicht mehr nach H1 zu fahren oder ob sie das selbst entschieden hat, ist schon deshalb nicht von Relevanz, da die Klägerin selbst angegeben hat, zwischenzeitlich bis zu sechsmal jährlich nach H1 zu fahren, was gegen die behauptete „Triggerung“ und ein dahingehendes Vermeidungsverhalten spricht.
Die Leistungseinschätzung durch die Rehabilitationsklinik basiert auf der fachärztlichen Auswertung des Rehabilitationsverlaufs, damit einer Beobachtung über mehrere Wochen, und ist unter Einbeziehung von Testungen zur beruflichen Belastungsfähigkeit erfolgt. Ausdrücklich vermerkt ist, dass die Leistungseinschätzung mit der Klägerin besprochen worden ist und von ihr geteilt wurde, sodass ihr Vorbringen, dass die Leistungseinschätzung nur auf ihrer Eigeneinschätzung beruhe, widerlegt und es daher nicht zu beanstanden ist, wenn G1 die dortigen Ergebnisse aus fachlicher Sicht würdigt, wie es im Übrigen seine Aufgabe ist.
Das Vorbringen, G1 habe eine PTBS bestätigen müssen, weil der ITQ-Test das Vorliegen einer solchen ergeben habe, ist schon deshalb abwegig, weil Diagnosen nicht aufgrund von Testverfahren und Selbstbeurteilungsbögen zu stellen sind, sondern die fachliche Leistung des Sachverständigen gerade darin besteht, die Ergebnisse solcher Testverfahren kritisch zu hinterfragen und mit dem aus fachlicher Sicht bestehenden klinischen Befund abzugleichen. Für eine Diagnosestellung einzig anhand von Testverfahren bedürfte es der sachverständigen Expertise nicht. Abgesehen davon, dass G1, wie oben dargelegt, klinisch das Bild einer PTBS nicht hat bestätigen können, ist seinen Ausführungen zu entnehmen, dass die aus fachlicher Sicht zu erwartende Auffälligkeiten bei anderen Tests ebenfalls nicht bestanden, was die fehlende Validität der Angaben und damit der Testergebnisse zusätzlich untermauert.
Letztlich stellt es das Sachverständigengutachten nicht in Frage und begründet keinen weiteren Ermittlungsbedarf, dass die Klägerin aufgrund ihrer eigenen medizinischen Beurteilung, für die ihr die Sachkunde fehlt, die Kausalitätsbeurteilung des Sachverständigen angreift und eine monokausale Verursachung sämtlicher Umstände ihrer Biographie postuliert.
Diese Grundannahme wird nämlich hinsichtlich der Suchtproblematik schon durch den Entlassungsbericht der Rehabilitationsklinik L2 widerlegt, dessen Schlussfolgerungen der Sachverständige G1 zuletzt bestätigt hat. Die Rehabilitationsklinik L2 hat nämlich herausgestellt, dass als externaler auslösender Stimulus für den Suchtmittelkonsum die Verfügbarkeit von Kokain im Freundeskreis gewesen ist, als internale auslösende Bedingung die Neugierde auf die Wirkung des Suchtmittels und die Antizipation einer positiven Wirkung zu sehen sind. Die sexuellen Traumatisierungen sieht die Klinik – ebenso wie G1 – lediglich als einen die Vulnerabilität der Klägerin für den Suchtmittelkonsum erhöhenden Faktor, neben einer genetischen Disposition, der emotionalen Vernachlässigung in der Kindheit, der überfordernden Verantwortungsübernahme für die vier jüngeren Geschwister und der frühen Verselbstständigung im 14. Lebensjahr. Schon L1 hat sowohl auf eine biographische Disposition wie auch auf die schwierigen familiären Verhältnisse hingewiesen, ohne dies allerdings in gebotener Weise bei der Abgrenzung zu nicht schädigungsbedingten Vorgängen (s.o.) zu würdigen und entsprechende Kausalitätsüberlegungen anzustellen. Es überzeugt daher, wenn G1 dem sexuellen Missbrauch – jedenfalls – nur einen untergeordneten Verursachungsbeitrag (von ihm auf circa 25 % beziffert), der den anderen Faktoren nicht wenigstens gleichwertig ist, zuschreibt und damit keine rechtlich wesentliche Ursächlichkeit sieht. Anders als die Klägerin glauben machen will, hat der Sachverständige schon gar nicht behauptet, dass bei Kindern aus einem entsprechenden Milieu stets mit derartigen Folgen zu rechnen ist, sondern hat einzelfallbezogen entschädigungsrelevante gegen nicht-entschädigungsrelevante Umstände abgegrenzt und bewertet.
In Rechnung zu stellen ist dabei auch, dass die Klägerin mehrfach angegeben hat, dass sie wegen der Depressionen der Mutter den Haushalt und die Geschwister hat versorgen müssen und deshalb nicht zur Schule gehen konnte. Der sexuelle Missbrauch war vor diesem Hintergrund nicht der Grund für das Unterlassen des Schulbesuchs. Ebenso hat die Klägerin – korrespondierend zu den Darlegungen der Klinik L2 – mehrfach beschrieben, dass es zu den ersten Drogenkontakten bei Besuchen von Diskotheken auf der R2 mit Freunden gekommen ist, also wiederum nicht im Kontext mit dem sexuellen Missbrauch.
Nicht unberücksichtigt bleiben kann weiter, dass die Klägerin angegeben hat, sich mit 14 Jahren den Missbrauchern widersetzt zu haben und deshalb von der Mutter aus der Wohnung geworfen worden zu sein, was jedenfalls deutlich macht, dass die Klägerin im Stande gewesen ist, sich ab einem bestimmten Alter erfolgreich zu wehren.
Soweit sie im Nachgang Schuldgefühle gegenüber ihrem Bruder entwickelt haben mag (vgl. dazu auch die Angaben gegenüber L1), weil dieser an ihrer Stelle von der Mutter mit zu den Kunden genommen worden sein soll, begründet dies wiederum keinen tätlichen Angriff gegen die Klägerin und ist damit auch nicht entschädigungsrelevant. Nichts anderes gilt dafür, wenn die Klägerin im Z1 W1 2018 angegeben hat, dass für sie gegenwärtig der Ärger darüber im Vordergrund stehe, dass ihr Bruder ein Telefonat der Mutter angenommen hat, die um Unterstützung für eine Gnadengesuch gebeten hat.
Wenn dem Bericht des Z1 W1 zu entnehmen ist, dass es zu einer erheblichen Verschlechterung durch die Nachricht von der Schwangerschaft und von dem Umstand, dass es ein Mädchen werden wird, gekommen ist, mögen hierdurch zwar Befürchtungen der Klägerin aufgrund ihrer biographischen Erlebnisse und besonders der negativen Erfahrungen im Verhältnis zu ihrer Mutter ausgelöst worden sein, die zu einer verstieften Auseinandersetzung mit der eigenen Mutterrolle geführt haben mag, ein entschädigungsrelevanter Sachverhalt begründet sich hieraus aber wiederum nicht.
Die Feststellungen des Sachverständigen G1 rechtfertigen eine Bewertung schädigungsbedingter Funktionseinschränkungen – unabhängig davon, dass er die als Schädigungsfolge bindend anerkannte PTBS nicht bestätigen konnte – mit einem GdS von 30 nicht. Die Anerkennung der Schädigungsfolge als solcher führt nämlich für sich betrachtet nicht zu einem bestimmten GdS, sondern die Funktionseinschränkungen hieraus sind zu bewerten. Auf die Frage, ob der Beklagte zu Recht Beschädigtengrundrente nach einem GdS von 30 gewährt, kommt es nicht an, da die Klägerin hierdurch nicht beschwert ist.
Nach den VG, Teil B, Nr. 3.7 begründen Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen in Form leichterer psychovegetativer oder psychischer Störungen einen GdB von 0 bis 20, stärkere Störungen mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit (z. B. ausgeprägtere depressive, hypochondrische, asthenische oder phobische Störungen, Entwicklungen mit Krankheitswert, somatoforme Störungen) einen GdB von 30 bis 40, schwere Störungen (z. B. schwere Zwangskrankheit) mit mittelgradigen sozialen Anpassungsschwierigkeiten einen GdB von 50 bis 70 und mit schweren sozialen Anpassungsschwierigkeiten einen GdB von 80 bis 100. Die funktionellen Auswirkungen einer psychischen Erkrankung, insbesondere wenn es sich um eine affektive oder neurotische Störung nach F30.- oder F40.- ICD-10 GM handelt, manifestieren sich dabei im psychisch-emotionalen, körperlich-funktionellen und sozial-kommunikativen Bereich (vgl. Philipp, Vorschlag zur diagnoseunabhängigen Ermittlung der MdE bei unfallbedingten psychischen bzw. psychosomatischen Störungen, MedSach 6/2015, S. 255 ff.). Diese drei Leidensebenen hat auch das Bundessozialgericht in seiner Rechtsprechung angesprochen (vgl. BSG, Beschluss vom 10. Juli 2017 – B 9 V 12/17 B –, juris, Rz. 2). Dabei ist für die GdB-Bewertung, da diese die Einbußen in der Teilhabe am Leben in der (allgemeinen) Gesellschaft abbilden soll, vor allem die sozial-kommunikative Ebene maßgeblich (vgl. Senatsurteil vom 12. Januar 2017 – L 6 VH 2746/15 –, juris, Rz. 61). Bei dieser Beurteilung ist auch der Leidensdruck zu würdigen, dem sich der behinderte Mensch ausgesetzt sieht, denn eine „wesentliche Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit“ meint schon begrifflich eher Einschränkungen in der inneren Gefühlswelt, während Störungen im Umgang mit anderen Menschen eher unter den Begriff der „sozialen Anpassungsschwierigkeiten“ fallen, der ebenfalls in den VG genannt ist. Die Stärke des empfundenen Leidensdrucks äußert sich nach ständiger Rechtsprechung des Senats auch und maßgeblich in der Behandlung, die der Betroffene in Anspruch nimmt, um das Leiden zu heilen oder seine Auswirkungen zu lindern. Hiernach kann bei fehlender ärztlicher oder der gleichgestellten (§§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 28 Abs. 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Krankenversicherung) psychotherapeutischen Behandlung durch – bei gesetzlich Versicherten zugelassene – Psychologische Psychotherapeuten in der Regel nicht davon ausgegangen werden, dass ein diagnostiziertes seelisches Leiden über eine leichtere psychische Störung hinausgeht und bereits eine stärker behindernde Störung im Sinne der GdB-Bewertungsgrundsätze darstellt (Senatsurteil vom 22. Februar 2018 – L 6 SB 4718/16 –, juris, Rz. 42; vgl. auch LSG Baden- Württemberg, Urteil vom 17. Dezember 2010 – L 8 SB 1549/10 –, juris, Rz. 31).
Ausgehend von diesen Maßstäben ist eine stärker behindernde Störung mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit jedenfalls schädigungsbedingt nicht objektiviert. Der Sachverständige G1 hat die Klägerin vielmehr als zu Zeit, Ort und Situation orientiert beschrieben. Die Auffassung war regelrecht und Konzentrationsstörungen zeigten sich nicht (vgl. zuvor schon das Gutachten des L1 und den Bericht der Rehabilitationsklinik L2). Formale Denkstörungen bestanden keine, der Gesprächsverlauf war zügig und die Antworten geordnet. Aus der Anamnese konnte der Sachverständige aus fachlicher Sicht keine Anhaltspunkte für ein ängstliches Vermeidungsverhalten ableiten, in der Untersuchung wirkte die Klägerin weder ängstlich, noch besorgt. Die Stimmung war stabil, es zeigte sich lediglich eine diskrete themenbezogene Labilität des Affekts. Interesse und Freude sind bei positiven Themen klar deutlich geworden, eine anhaltende Beeinträchtigung war somit nicht gegeben. Überzeugend legt der Sachverständige weiter dar, dass Lebendigkeit und Tatkraft nicht in einem den Alltag beeinflussenden Maß herabgesetzt sind, die Klägerin antriebsstark und motorisch ruhig wirkte und die Psychomotorik nicht gesteigert oder vermindert war.
Dies untermauert der Sachverständige in tatsächlicher Hinsicht damit, dass der berichtete Alltag und die Alltagsbewältigung unauffällig gewesen sind, gute soziale Kontakte beschrieben und positive Aktivitäten unternommen werden. Als Hobbys sind Lesen, Reisen und Kochen angegeben worden, daneben hat die Klägerin über regelmäßige Besuche im Fitnessstudio berichtet sowie über eine Kreuzfahrt mit der Aida und Urlaube und Kroatien und Holland. Neben dem somit erhaltenden Interessenspektrum ist auch die Strukturierungsfähigkeit der Klägerin nicht relevant eingeschränkt, sie versorgt – nach der Trennung vom Ehemann – als Alleinerziehende die Tochter und den Haushalt selbst. In diesem Zusammenhang hat bereits L1 in seinem Gutachten vermerkt, dass die Klägerin als Mutter einen voll ausgefüllten Alltag hat.
Aus den Testverfahren folgt nichts anderes, da diese, so G1 weiter, für Situationen, in denen sich Dissimulation und Aggravation mischen – wie bei der Klägerin – nicht validiert sind. Daneben passt die aus dem Selbstbeurteilungsbogen ersichtliche schwere Symptomatik einer PTBS weder zum klinischen Bild, noch dazu, dass nur eine minimale Depression zur Darstellung gekommen ist, während im entsprechenden Testverfahren (BDI-II) aus fachlicher Sicht ein hoher Wert zu erwarten stand, wie G1 weiter darlegt. Korrespondierend hierzu war weder Escitalopram noch das Abbauprodukt Desmethylescitalopram nachweisbar, was gegen eine regelmäßige Einnahme und ein Absetzen erst kurz vor der Untersuchung, wie von der Klägerin behauptet, spricht.
Die von der Klägerin behaupteten Widersprüchlichkeiten hinsichtlich der Ausführungen des Sachverständigen zum GdS und GdB bestehen nicht. Unabhängig davon, dass die Frage nach der Höhe des GdS (ebenso wie die nach der Höhe des GdB) eine rechtliche und keine medizinische ist, ist der Sachverständige seiner Aufgabe gerecht geworden, aus fachlicher Sicht eine Abgrenzung von Verursachungsanteilen vorzunehmen. Er hat damit sein in der Kausalitätsbewertung gefundenes Ergebnis in die Bewertung des GdS übersetzt und ergänzend noch eine finale Betrachtung des Gesamtzustandes der Klägerin vorgenommen und – für das Sachverständigengutachten nicht tragend – zur Höhe des GdB – also schädigungsunabhängig – ausgeführt. Dabei muss weiter berücksichtigt werden, dass die von G1 vorgenommene Abgrenzung schon nur insofern hypothetisch vorgenommen worden ist, als er einen zu bewertenden Mitwirkungsanteil, den er selbst nicht sieht, als gegeben unterstellt hat, unter dessen Annahme aber zu keinem höheren GdS als 20 gelangt ist.
In Rechnung zu stellen ist dabei weiter, dass sich bei der Untersuchung ein – wie oben dargelegt schädigungsunabhängiger – Substanzkonsum gezeigt hat, den die Klägerin erst im Nachgang zu der Begutachtung gegenüber G1 eingeräumt hat. Der Sachverständige hat zu den Blutwerten nämlich herausgestellt, dass diese eine Vergiftung mit Amphetamin belegen und die Fahrtauglichkeit der Klägerin – die mit dem PKW angereist war – eigentlich ausgeschlossen haben. In diesem Zusammenhang hat G1 weiter ausgeführt, diagnostisch zwar von einer leichten Persönlichkeitsstörung bei der Klägerin auszugehen, deren wirkliche Ausprägung aber aufgrund des Substanzkonsums schon nicht zu objektivieren ist, die er aber auch nicht in kausalem Zusammenhang mit den schädigenden Ereignissen sieht, da die Klägerin in einem Umfeld aufgewachsen ist, welches die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen begünstigt, was durch die dokumentierten Straftaten – so G1 – zusätzlich untermauert wird.
Eine Erhöhung des GdS aufgrund einer besonderen beruflichen Betroffenheit (§ 30 Abs. 2 SGG), bei der es sich lediglich um einen Umstand handelt, der für die Bemessung des GdS in Betracht kommt und der deshalb bei der Höhe der Grundrente zu berücksichtigen ist (vgl. schon Senatsurteil vom 24. Januar 2017 – L 6 VH 789/15 –, juris, Rz. 64, so auch BSG, Urteil vom 13. Dezember 1979 – 9 RV 56/78 –, juris, Rz. 19), kommt nicht in Betracht. Denn unabhängig davon, dass der Senat nach den obigen Ausführungen bereits nicht feststellen kann, dass es zu einem schädigungsbedingten Abbruch der Schulausbildung gekommen ist, hat die Klägerin jedenfalls einen Ausbildungsabschluss erreicht und die Testergebnisse der Rehabilitationsklinik L2 belegen ein vollschichtiges Leistungsvermögen sowohl in dieser Tätigkeit als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Darauf, dass auch keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Klägerin einen darüber hinausgehenden Bildungsabschluss hätte erreichen können, kommt es somit nicht entscheidungserheblich an.
Nicht relevant ist weiter, dass die Klägerin in der Klinik mitgeteilt hat, sich zunächst weiter um ihre Tochter kümmern und erst wenn diese im Kindergarten ist mit einer Halbtagstätigkeit beginnen zu wollen. Weder diese Entscheidung für familiäre Belange noch eventuelle Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt alleine begründen – abgesehen von den nicht erwiesenen schädigungsbedingten Nachteilen – eine besondere berufliche Betroffenheit.
Aus Vorstehendem folgt gleichzeitig, dass die Klägerin keinen Berufsschadensausgleich beanspruchen kann.
Nach § 30 Abs. 3 BVG erhalten rentenberechtigte Beschädigte, deren Einkommen aus gegenwärtiger oder früherer Tätigkeit durch die Schädigungsfolge gemindert ist, nach Anwendung des § 30 Abs. 2 BVG einen Berufsschadensausgleich in Höhe von 42,5 v. H. des auf volle Euro aufgerundeten Einkommensverlustes (§ 30 Abs. 4 BVG) oder, falls dies günstiger ist, einen Berufsschadensausgleich nach § 30 Abs. 6 BVG. Ist die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gemindert, weil das Erwerbseinkommen in einem in der Vergangenheit liegenden Zeitraum, der nicht mehr als die Hälfte des Erwerbslebens umfasst, schädigungsbedingt gemindert war, so ist die Rentenminderung abweichend von § 30 Abs. 4 Satz 1 BVG der Einkommensverlust (§ 30 Abs. 4 Satz 3 BVG). Wer also in der Vergangenheit zeitweise schädigungsbedingte Einkommenseinbußen hatte, die über niedrigere Rentenversicherungsbeiträge zu Lücken im Versicherungsverlauf und damit zu einer niedrigeren Rente geführt haben, erhält insoweit einen sogenannten Renten-BSA (vgl. Dau in: Knickrehm, a. a. O., § 30 BVG, Rz. 47). Wenn die Zeiten schädigungsbedingt geminderten Einkommens dagegen mehr als die Hälfte des Erwerbslebens ausgemacht haben, bleibt es bei der Anwendung des § 30 Abs. 4 Satz 1 BVG (vgl. Bay. LSG, Urteil vom 15. Dezember 2016 – L 18 VS 5/10 –, juris, Rz. 39). Für die Feststellung des Vergleichseinkommens ist in einem ersten Schritt zu ermitteln, welche berufliche Position („Hätte-Beruf“) ohne die Schädigung und ihre Folgen wahrscheinlich erreicht worden wäre (vgl. Dau in: Knickrehm, a. a. O., § 30 Rz. 31, 32). Regelmäßig ist dabei von dem Beruf auszugehen, aus dem der Beschädigte seinerzeit durch die Schädigung verdrängt worden ist, einschließlich der Entwicklung, die ein Nichtbeschädigter in diesem Beruf wahrscheinlich genommen hätte. Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass nach den objektiven Umständen mehr für als gegen den hypothetischen Berufserfolg spricht. Die bloße Möglichkeit eines beruflichen Aufstiegs genügt nicht (vgl. LSG Hamburg, Urteil vom 27. Februar 2018 – L 3 VW 7/15 –, juris, Rz. 40; BSG, Urteil vom 15. September 1988 – 9/9a RV 50/87 –, juris, Rz. 12).
Sind Beschädigte infolge einer vor Beginn der Berufsausbildung erlittenen Schädigung in ihrem beruflichen Werdegang behindert, so ist nach § 5 Satz 1 Verordnung zur Durchführung des § 30 Abs. 3 bis 12 und des § 40a Abs. 1 und 5 BVG (Berufsschadensausgleichsverordnung - BSchAV) das Durchschnittseinkommen orientiert an den Grundgehältern der Bundesbesoldungsordnung A zu ermitteln. Die Eingruppierung ist nach Veranlagung und Fähigkeiten sowie sonstigen Lebensverhältnissen der Beschädigten vorzunehmen. Durchschnittseinkommen ist mindestens das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 5, zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz. Bei vermutlichem Abschluss einer Berufsausbildung ist das in § 3 Abs. 1 BSchAV für Beschädigte mit abgeschlossener Berufsausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen maßgeblich, bei vermutlichem Bestehen einer Techniker- oder Meisterprüfung das in § 3 Abs. 1 BSchAV für Beschädigte mit abgelegter Techniker- oder Meisterprüfung bestimmte Durchschnittseinkommen, bei vermutlichem Fachhochschulabschluss das in § 3 Abs. 1 BSchAV für Beschädigte mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen und bei vermutlichem Hochschulabschluss das in § 3 Abs. 1 BSchAV für Beschädigte mit abgeschlossener Hochschulausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen. Der Berufsschadensausgleich ist frühestens nach dem vermutlichen Abschluss der beruflichen Ausbildung zu gewähren (§ 5 Satz 2 BSchAV).
Diese Voraussetzungen sind bei der Klägerin ebenfalls nicht erfüllt. Wie oben bereits dargelegt, ist nicht belegt, dass die Klägerin schädigungsbedingt die Schule nicht weiter besucht und hierdurch Nachteile bei der Aufnahme einer Berufsausbildung erlitten hat. Vielmehr ergibt sich aus der Aktenlage, dass dem Schulbesuch zum einen entgegenstand, dass sie den Haushalt und die Geschwister versorgen musste und zum anderen ein erheblicher Drogenkonsum bestanden hat. Daneben hat die Klägerin – zuletzt gegenüber G1 – angegeben, dass sie nie in finanziell beengten Verhältnissen gelebt hat und immer für ihren Lebensunterhalt hat aufkommen können – sogar ihre Geschwister unterstützt haben will. Letztlich hat sie eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und bei der letzten Arbeitsstelle nach ihren Angaben auch ein gutes Zeugnis erhalten. Anhaltspunkte dafür, dass ein höherer Ausbildungsabschluss hätte erreicht werden können, bestehen unabhängig davon, dass die Schule schon nicht schädigungsbedingt abgebrochen worden ist, nicht. Die Rehabilitation in der Klinik L2 hat darüber hinaus ergeben, dass ein vollschichtiges Leistungsvermögen sowohl für die erlernte Tätigkeit als Rechtsanwaltsfachangestellte besteht, wie auch für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Klägerin hat lediglich angegeben, sich zunächst um die Betreuung der Tochter kümmern zu wollen, bevor sie sich wieder eine Stellung sucht. Gesundheitsbedingte Hinderungsgründe zur Aufnahme einer Tätigkeit bestehen damit – auch schädigungsunabhängig – keine. Anders als die Klägerin glauben machen will, beruhte die Leistungseinschätzung nicht lediglich auf ihren eigenen Angaben (vgl. bereits oben), sondern der Entlassungsbericht vermerkt, dass in der Arbeitstherapie durchgehend gute Leistungen und Ergebnisse erbracht worden sind. Arbeitsanleitungen und deren Umsetzung funktionierten problemlos, sodass auch die behaupteten Konzentrationsstörungen – die bei den medizinischen Untersuchungen ebenfalls nicht zu objektivieren waren (vgl. bereits oben) – dem Arbeitserfolg jedenfalls nicht entgegenstanden. Betont wird in dem Bericht weiter, dass sich die Klägerin gut in der Arbeitsgruppe hat integrieren können und die interpersonelle Interaktion angemessen, freundlich und kooperativ gewesen ist. Die gegenteilige Einschätzung des L1, dass Rehabilitationsmaßnahmen nicht erfolgversprechend seien und mit einer Änderung frühestens in fünf Jahren gerechnet werden könnte, ist daher in tatsächlicher Hinsicht in aller Deutlichkeit widerlegt.
Soweit G1 bei der Klägerin dennoch einen Rehabilitationsbedarf sieht, folgt hieraus schon deshalb nichts anderes, da er diesen im Zusammenhang mit schädigungsunabhängigen Umständen annimmt und insbesondere auf die Suchtproblematik verweist. Selbst wenn der Rehabilitationsbedarf als schädigungsbedingt angesehen würde, ergäbe sich keine andere rechtliche Beurteilung, da ein Anspruch auf Berufsschadensausgleich – ebenso wie auch eine Höherbewertung des GdS nach § 30 Abs. 2 BVG – dann nach § 29 BVG ausgeschlossen wäre.
Nach § 29 BVG entsteht ein Anspruch auf Höherbewertung des GdS nach § 30 Abs. 2 BVG wegen besonderer beruflicher Betroffenheit, auf Berufsschadensausgleich sowie auf Ausgleichsrente, wenn Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erfolgversprechend und zumutbar sind, frühestens in dem Monat, in dem diese Maßnahmen abgeschlossen werden.
In der Vorschrift findet der auch im Versorgungsrecht geltende Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“ seinen Ausdruck, wobei es nicht von Bedeutung ist, durch welchen Träger die Maßnahme durchgeführt wird (vgl. BSG, Urteil vom 18. Oktober 1995 – 9 RV 18/94 –, juris, Rz. 19). § 29 BVG schreibt ein zeitliches Nacheinander von Maßnahmen zur Rehabilitation und dem Anspruch auf einkommensabhängige Versorgungsleistungen vor. Letztere entstehen erst nach erfolgreichem Abschluss oder nach Scheitern zumutbarer und erfolgversprechender Rehabilitationsmaßnahmen. Die Priorität von Rehabilitationsmaßnahmen gilt uneingeschränkt auch in der Zeit, um die sie sich hinauszögern, weil der Beschädigte nicht mitwirkt. Entfallen während dieser Zeit Zumutbarkeit und/oder Erfolgsaussicht, so wirkt der Prioritätsgrundsatz nicht mehr – nur – anspruchsaufschiebend, sondern anspruchsausschließend. Unabhängig davon, ob ein konkretes, etwa nach Ziel, Zeit, Ort, Inhalt, Dauer und Veranstalter der Rehabilitationsmaßnahme sowie nach begleitenden Leistungen bestimmtes Angebot der Verwaltung zu fordern ist, muss ein Beschädigter, für den es erfolgversprechende und zumutbare Rehabilitationsmaßnahmen gibt, vorab über die leistungsrechtliche Bedeutung der Aussicht auf Rehabilitation und die Folgen fehlender Mitwirkung belehrt werden. Geschieht das nicht, so endet der Anspruchsaufschub auch denn, wenn die Rehabilitationsbemühungen sich verzögern oder scheitern, weil der Beschädigte nicht mitwirkt. Dies folgt aus Ziel, Zweck und Funktion der Vorschrift. Sie beruht zwar weiter auf dem im Versorgungsrecht seit langem geltenden Gedanken, dass nicht mit Rente abgefunden werden soll, wem nicht durch z. B. Umschulung geholfen werden kann, sie zielt aber nicht darauf ab, Rehabilitationsunwillige durch Vorenthalten einkommensabhängiger Leistungen zu bestrafen und auf diese Weise Haushaltsmittel einzusparen. Kommt es dazu, hat die Vorschrift ihr eigentliches Ziel nicht erreicht. § 29 BVG soll sicherstellen, dass der zur Schadensminderung verpflichtete Beschädigte zu seinem eigenen Besten an einer von Amts wegen durchzuführenden beruflichen Rehabilitation mitwirkt und so den Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“ verwirklicht. Die dazu angedrohte Sanktion des § 29 BVG kann das Verhalten des Beschädigten aber nur dann dem Normzweck entsprechend steuern, wenn er von dem drohenden Nachteil weiß. Nur so verstanden fügt sich die Vorschrift in die im Sozialrecht allgemein geltenden Regeln über die Folgen fehlender Mitwirkung ein (vgl. BSG, Urteil vom 17. Juli 2008 – B 9/9a VS 1/06 R –, juris, Rz. 17).
§ 29 BVG erfordert somit eine Prognoseentscheidung hinsichtlich der Maßnahmen zur Rehabilitation, wobei grundsätzlich gilt, dass sachgerechte Prognosen auf den erhobenen Daten und Fakten und damit auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit beruhen, auf deren Basis unter Berücksichtigung zu erwartender Veränderungen eine Vorausschau für die Zukunft getroffen wird. Dabei sind alle bei der Prognosestellung für die Beurteilung der künftigen Entwicklung erkennbaren Umstände zu berücksichtigen, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind und Einfluss auf die zu beurteilenden Umstände haben. Maßgebend sind die Verhältnisse zur Zeit der Prognoseentscheidung, sodass Grundlage der Prognose nur bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens erkennbare Umstände sein können (vgl. BSG, Urteil vom 3. August 2016 – B 6 KA 20/15 R –, juris, Rz. 24)
Ausgehend von diesen Maßstäben hat der Sachverständige G1 – jedenfalls – überzeugend aufgezeigt, dass auch weiterhin – entsprechend dem Ergebnis der Rehabilitation in der Klinik L2 – keine ungünstige Prognose bei der Klägerin angenommen werden kann, sodass Rehabilitationsmaßnahmen jedenfalls erfolgversprechend wären.
Die Ansprüche auf Höherbewertung des GdS und auf Berufsschadensausgleich wären damit selbst bei unterstellten schädigungsbedingten Einschränkungen nach § 29 BVG ausgeschlossen.
Letztlich besteht kein Anspruch auf Ausgleichsrente. Nach § 32 Abs. 1 BVG haben Anspruch auf Ausgleichsrente Schwerbeschädigte, wenn sie infolge ihres Gesundheitszustands oder hohen Alters oder aus einem von ihnen nicht zu vertretenden sonstigen Grund eine ihnen zumutbare Erwerbstätigkeit nicht oder nur in beschränktem Umfang oder nur mit überdurchschnittlichem Kräfteaufwand ausüben können (§ 32 Abs. 2 BVG). Schwerbeschädigt ist die Klägerin indessen, wie oben dargelegt, nicht.
Den Antrag nach § 109 SGG hat der Senat abgelehnt. Zum einen ist dieser verspätet gestellt worden, nachdem bereits mit Verfügung vom 28. Mai 2025 darauf hingewiesen wurde, dass kein weiterer Ermittlungsbedarf gesehen wird und die Ladung zum Termin dem Bevollmächtigten bereits am 11. September 2025 zugestellt worden ist (vgl. Empfangsbekenntnis Bl. 60 Senatsakte), sodass es eine grobe Nachlässigkeit begründet, den Antrag erst am 7. November 2025 zu stellen und seine Zulassung auch zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führen würde. Zum anderen ist von der Klägerin kein Arzt benannt worden, sondern ein Psychologe, der als Sachverständiger nach § 109 SGG ausscheidet (vgl. Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, a.a.O., § 109 Rz. 5), sodass schon kein taugliches Beweismittel bezeichnet worden und der Antrag damit unzulässig ist.
Die Berufung konnte daher keinen Erfolg haben und war zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG.
Gründe, die Revision zuzulassen, sind nicht gegeben, da die Voraussetzungen des § 160 Abs. 2 SGG nicht vorliegen.
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 4. Dezember 2025