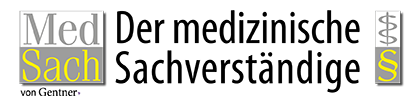Fachleute schätzen die Erkrankung bislang uneinheitlich ein: Während ME/CFS von einigen als dramatisch unterdiagnostiziert oder vernachlässigt angesehen wird, stellen andere es als primär somatisch bedingte Erkrankung in Frage. So wird mit dem Begriff der „Enzephalomyelitis“ eine Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks postuliert, die in aller Regel bei ME/CFS jedoch nicht nachweisbar ist.
Es handelt sich um ein vielgestaltiges, nur schwer einzugrenzendes Beschwerdebild, das teilweise anatomisch und physiologisch nicht erklärbare Formen annimmt. Auch ist es in den letzten fünf Jahrzehnten nicht gelungen, ME/CFS mit Biomarkern wie Blut- oder Liquor-Tests oder in der Bildgebung des Gehirns (v. a. MRT) zu identifizieren. Es überlappt zudem mit zahlreichen Erkrankungsphänomenen aus der Inneren Medizin, Rheumatologie, Endokrinologie, Psychiatrie, Psychosomatik und Infektiologie.
Bisher existiert keine wissenschaftlich erwiesene wirksame Therapie, welche auf die vermuteten biologischen Mechanismen abzielt. Daher gibt es einen „Wildwuchs“ von nicht evidenzbasierten, zum Teil in ihrer vermuteten Effektivität widerlegten, Behandlungsangeboten (i. d. R. mit Selbstzahlung durch Betroffene). Wichtig ist daher die Beratung von Betroffenen darüber, dass es bisher keine speziell für die Behandlung von ME/CFS zugelassenen Medikamente oder andere Therapieverfahren gibt, so die DGN.
Interdisziplinäre Versorgungsangebote für Menschen mit schwerem ME/CFS werden hingegen dringend benötigt. Nicht zuletzt zur Prävention der durch die oft sehr belastenden Symptome hervorgerufenen Suizidgedanken sei dabei eine psychiatrische Mitbetreuung geboten.
Zukünftige Forschungsansätze sollten zudem nicht vorwiegend auf immunologische Erklärungsansätze gerichtet sein: Es sollten auch diagnostische und therapeutische Verfahren aus anderen Bereichen der Medizin, einschließlich dem Bereich psychischer und psychosomatischer Erkrankungen und funktioneller Störungen, miteinbezogen werden, um der Vielgestaltigkeit des Krankheitsbildes gerecht zu werden.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden