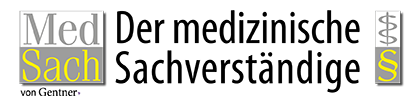In der Zeitschrift „Versicherungsrecht“ wird immer wieder ausführlich über Urteile berichtet, die für den medizinischen (Gerichts-)Sachverständigen interessant sind (vgl. zuletzt Heft 2/2019, S. 71 ff). Zudem finden sich auch interessante Zusammenfassungen zu einschlägigen Themen aus juristischer Sicht.
Hier eine Zusammenstellung einiger kurzer Referate über entsprechende Publikationen zur Arzthaftpflicht, zur privaten Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung sowie zur privaten Krankenversicherung.
Arzthaftpflicht
Gesteigerte Pflicht der Befunderhebung nach einem Unfall bei diabetischer Neuropathie
Die Kenntnis einer diabetischen Neuropathie kann gesteigerte Pflichten der Befunderhebung nach einem Unfall begründen, wie ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 9.1.2019 (AZ: 5 U 13/17) zeigt.
Hier die Leitsätze des Urteils:
Ein entsprechendes Versäumnis stellt sich als Befunderhebungsmangel und nicht als Diagnosefehler dar.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 12: 764–766)
Schmerzensgeld bei grob fehlerhaft nicht behandeltem septischem Schock
Ein Arzt im Krankenhaus, der auf Hinweise der Krankenschwester, die auf einen beginnenden septischen Schock des Patienten hindeuten, nicht zumindest Anordnungen zu engmaschiger und intensiver Überwachung trifft, handelt grob fehlerhaft, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Köln mit Urteil vom 5.3.2018 (AZ: 5 U 28/16).
Der kritische Zustand des Patienten sei von dem diensthabenden Arzt nach dem Inhalt der Dokumentation vollständig verkannt worden, so der Gerichtssachverständige in seinen überzeugenden Ausführungen. Dies habe selbst einem Berufsanfänger und erst recht einem Facharzt nicht passieren dürfen.
Verstirbt der Patient infolge des dann grob fehlerhaft nicht behandelten septischen Schocks binnen weniger Stunden (hier knapp vier Stunden), ist allerdings ein höheres Schmerzensgeld als 2.000 Euro nicht gerechtfertigt, so das OLG.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 7: 423–427)
Was bedeutet „gelegentlich“ in der Patientenaufklärung?
Eine statistische Häufigkeit im einstelligen Prozentbereich lässt sich nach allgemeinem Sprachgebrauch unter den Begriff „gelegentlich“ fassen. Für die Aufklärung von Patienten vor ärztlichen Eingriffen gelten insoweit keine Besonderheiten, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 29.1.2019 (AZ: IV ZR 117/18, Frankfurt/M.). Somit kann (wie hier im Streitfall) vor einer Knieprothesen-Implantation das Risiko einer Prothesenlockerung in Höhe von 8,71 % als „gelegentlich“ bezeichnet werden.
Entgegen der Revision des Klägers haben sich Wahrscheinlichkeitsangaben im Rahmen der Selbstbestimmungsaufklärung vor einer ärztlichen Behandlung dagegen grundsätzlich nicht an den in Beipackzetteln für Medikamente verwendeten Häufigkeitsdefinitionen des Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) zu orientieren. Danach gilt eine Häufigkeit von 8,71 % nicht als „gelegentlich“, sondern als „häufig“; als „gelegentlich“ gelten nach dem MedDRA dagegen Häufigkeiten von 0,1 % bis 1,0 %.
Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese – vom sonstigen allgemeinen Sprachgebrauch abweichende – Definition für die im Streitfall relevante, die Eingriffsaufklärung betreffende Kommunikation zwischen Arzt und Patient allgemein durchgesetzt haben, erklärte der BGH – auch wenn in der Rechtsprechung teilweise die Auffassung vertreten werde, Wahrscheinlichkeitsangaben hätten sich an den für Beipackzetteln für Medikamente gebräuchlichen Häufigkeitsdefinitionen des MedDRA zu orientieren.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 11: 688–691)
Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsbild klären vor Beauftragung des medizinischen Gutachters
Wenn im Prozess darum gestritten wird, ob ein Versicherungsnehmer berufsunfähig ist, sind regelmäßig zumindest das Berufsbild des Versicherungsnehmers und die medizinischen Voraussetzungen der Berufsunfähigkeit streitig. Solche Fälle erfordern meist sehr zeitaufwändige, mehrstufige Beweisaufnahmen,
erklären Bernd Wermeckes und Oliver Seggewiße, welche als Vizepräsident bzw. Richter der für Streitfragen aus Versicherungsvertragsverhältnissen zuständigen Kammer des Landgerichts (LG) Kleve angehören.
Grundsätzlich ist der Versicherungsnehmer für den Versicherungsfall – und damit auch für das Berufsbild – darlegungs- und beweispflichtig. Dabei reicht es nicht aus, lediglich die Berufsbezeichnung anzugeben; vielmehr sind die ausgeübten Tätigkeiten so konkret zu beschreiben, dass sich ein Dritter ein Bild von der Tätigkeit des Versicherungsnehmers machen kann (so der Bundesgerichtshof vom 29.11.1995).
Falls im Prozess das konkret vom Versicherungsnehmer ausgeübte Berufsbild streitig ist, muss grundsätzlich zuerst darüber Beweis erhoben werden. Das Berufsbild muss zunächst zur Überzeugung des Gerichts feststehen, bevor dieses die Beweisfragen an den medizinischen Sachverständigen formulieren kann; anderenfalls wüsste der Sachverständige nicht, in Bezug auf welches Berufsbild er beurteilen soll, ob (körperliche) Beeinträchtigungen eine weitere Berufsausübung verhindern.
Ein Sachverständigengutachten, welches ohne konkrete Feststellung des Berufsbildes eingeholt wird, ist keine tragfähige Grundlage, um eine Berufsunfähigkeit festzustellen.
(Wermeckes B, Seggewiße O; Versicherungsrecht 70 (2019) 5: 271–274)
Nachprüfung in der Berufsunfähigkeitsversicherung:
Änderung des Gesundheitszustandes?
Bei der Nachprüfung in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu klären, ob sich der Gesundheitszustand des Versicherten, der eine Berufsunfähigkeitsrente bezieht, seit der damaligen Erklärung des Leistungsanerkenntnisses so gebessert hat, dass der Grad der Berufsunfähigkeit zumindest unter 50 % gesunken ist (so dass der Versicherer dann die Berufsunfähigkeitsrente nicht mehr weiter leisten muss).
Wie es zu werten ist, wenn der Versicherte behauptet, sein Gesundheitszustand habe sich tatsächlich gar nicht verbessert, zeigt folgender aktueller Fall:
Für den im Nachprüfungsverfahren vorzunehmenden Vergleich zwischen dem Gesundheitszustand bei Anerkenntnis und demjenigen im Nachprüfungsverfahren kommt es darauf an, welche Feststellungen und Bewertungen der (beweispflichtige) Versicherer seinem Anerkenntnis zugrunde gelegt hat, erklärte das Berliner Kammergericht (KG) mit Beschlüssen vom 9.10.2018 und vom 13.11.2018.
Auf dieser Grundlage sind eine tatsächliche Verbesserung des Gesundheitszustandes und sich eine daraus ergebende Verminderung des Grades der Berufsunfähigkeit zu prüfen. Auf einen möglicherweise abweichenden, dem Versicherer aber zum Zeitpunkt des Anerkenntnisses unbekannten Zustand kann sich der Versicherte im Nachprüfungsverfahren daher nicht berufen und nicht geltend machen, eine Besserung seines ursprünglichen tatsächlichen Gesundheitszustandes sei nicht festgestellt worden, so der ausführliche Leitsatz zu diesen Beschlüssen.
Was diesen – für einen Nicht-Juristen wohl nur schwer verständlichen – Ausführungen zugrunde liegt, ergibt sich aus den weiteren Ausführungen des Gerichts:
Im Ergebnis der erstinstanzlich durchgeführten Beweisaufnahme steht fest, so das KG, dass sich die Berufsunfähigkeit des Klägers im Zeitraum zwischen dem Leistungsanerkenntnis und der Begutachtung im Nachprüfungsverfahren (ca. fünf Jahre später) auf weniger als 50 % gemindert hatte.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist als Ausgangspunkt (im Nachprüfungsverfahren) in die Vergleichsbetrachtung der Gesundheitszustand einzubeziehen, wie er dem Anerkenntnis (auf Leistung einer Berufsunfähigkeitsrente) zugrunde gelegen hat. Damit sind die Feststellungen und Bewertungen gemeint, die der Versicherer seinem Anerkenntnis zugrunde gelegen hat, und nicht der etwaig abweichende, tatsächliche Gesundheitszustand. Denn die Bindungswirkung des Anerkenntnisses reicht nur so weit, als dem Versicherer Informationen über den Gesundheitszustand des Versicherten vorgelegen haben. Von dem auf der Grundlage dieser Informationen abgegebenen Anerkenntnis soll er später ohne den Nachweis tatsächlicher Veränderungen nicht mehr abweichen können.
Sollte der tatsächliche Gesundheitszustand des Versicherten zur Zeit des Leistungsanerkenntnisses tatsächlich besser gewesen sein, als sich aus den damaligen, dem Versicherer vorliegenden Befunden oder Gutachten ergab, ist der Versicherte hingegen nicht schutzwürdig. Er kann sich deshalb nicht darauf berufen, dass die damals der Beurteilung zugrunde gelegten ärztlichen Diagnosen nicht bzw. nicht in diesem Ausmaß vorgelegen haben und dass sich daher gar keine Verbesserung des schon immer gegebenen Gesundheitszustandes ergeben habe.
Dies gilt erst recht, wenn (wofür im konkreten Fall Anhaltspunkte vorlagen) der Versicherte damals durch die Angabe bestimmter Beschwerden gegenüber den ihn behandelnden Ärzten die Ausstellung unzutreffender Befundberichte ausgelöst hat, denen dann der Versicherer bei seiner Leistungsanerkenntnis Glauben geschenkt hat, betonten die Berliner Richter. Eine Berufung des Versicherten auf diese unzutreffenden Befunde, auf deren Grundlage er jahrelang eine Berufsunfähigkeitsrente bezogen hat, wäre nach § 242 BGB grob treuwidrig.
(Versicherungsrecht 70 (201) 3: 150–152)
Erneute Anhörung des Sachverständigen bei abweichender Beurteilung durch das Berufungsgericht erforderlich
Wenn ein Berufungsgericht die Ausführungen des Sachverständigen in der vorherigen Instanz abweichend von deren Entscheidung würdigen will, bedarf es einer erneuten Anhörung des Sachverständigen, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 6.3.2019 (AZ: IV ZR 128/18). Das gilt insbesondere dann, wenn es ein anderes Verständnis der Ausführungen des Sachverständigen seiner Entscheidung zugrunde legen und damit andere Schlüsse aus diesen ziehen will als der Erstrichter.
Hier ging es um die Frage, ob der Kläger, ein Sachbearbeiter im Innendienst einer Versicherung, wegen einer krankhaften Überempfindlichkeit gegenüber diversen, insbesondere in der Büroluft vorhandenen Chemikalien berufsunfähig (im Sinne der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung) war. Der Kläger hatte angegeben, beim Einatmen von Chemikalien, etwa aus Ausdünstungen von Teppichklebern oder von Drucker-Tonerstaub, unter Beschwerden zu leiden wie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Kopf- und Gelenkschmerzen, Hautirritationen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Das vorher zuständige Landgericht (LG) hatte der Klage stattgegeben, da der von ihm beauftragte umweltmedizinische Sachverständige ausgeführt hatte, der Kläger sei aktuell nicht imstande, seinen Beruf im Versicherungsinnendienst auszuüben. Er war auf Grundlage seiner Anamnese davon ausgegangen, dass die vom Kläger geschilderten Beschwerden wie Einschränkungen der Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit, Durchfälle etc. tatsächlich bestünden und dass ursächlich hierfür – auch wenn dies organisch (etwa mittels Allergietestung) nicht nachweisbar sei – eine krankheitswerte Reaktion des Klägers auf in der Umwelt vorhandene chemische Stoffe sei. Unter diesen Umständen sei ihm ein regelhaftes Arbeiten nicht mehr möglich.
Dagegen hatte das anschließend angerufene Oberlandesgericht (OLG) die Klage insgesamt mit der Begründung abgewiesen, dass – entgegen der Auffassung des LG – die Feststellungen des umweltmedizinischen Sachverständigen die Annahme einer Berufsunfähigkeit nicht rechtfertigten. Der Sachverständige sei vielmehr so zu verstehen, dass der Kläger meine, krank zu sein, bzw. erwarte, krank zu werden, und er wegen der Furcht vor den Auswirkungen von Chemikalien in den Büroräumen diese meide. Somit sei nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass der Kläger an einer Erkrankung leide, so das OLG.
Dadurch, dass das OLG als Berufungsgericht den umweltmedizinischen Sachverständigen nicht erneut angehört hat, obwohl es dessen Ausführungen anders gewürdigt hat als das LG, hat es jedoch den Anspruch des Klägers auf Gewährung rechtlichen Gehörs in entscheidungserheblicher Weise verletzt, rügte der BGH.
Zwar steht es grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen des Berufungsgerichts, ob und inwieweit eine im ersten Rechtszug durchgeführte Beweisaufnahme zu wiederholen ist. Allerdings bedarf es dann einer erneuten Anhörung des Sachverständigen durch das Berufungsgericht, wenn es dessen Ausführungen abweichend von der Vorinstanz würdigen will, insbesondere ein anderes Verständnis der Ausführungen des Sachverständigen zugrunde legen und damit andere Schlüsse ziehen will als der Erstrichter.
Diese „Gehörsverletzung“ ist entscheidungserheblich, so der BGH. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Berufungsgericht anders entschieden hätte, wenn es den umweltmedizinischen Sachverständigen selbst zu den Ergebnissen seiner Begutachtung angehört hätte.
Kommentar aus medizinisch-gutachtlicher Sicht
Die Ausführungen des BGH sind grundsätzlich durchaus einleuchtend. Aus medizinischer Sicht erscheinen die Ausführungen des Gutachters (wie sie hier dargestellt werden) allerdings äußerst problematisch:
Bei dem vom Kläger angegebenen Beschwerdebild handelt es sich offensichtlich um die sogenannte „Multiple Chemical Sensitivity“ (MCS; multiple Chemikalien-Überempfindlichkeit), bei welcher bei Niedrigdosisexpositionen gegenüber alltäglichen Chemikalien uncharakteristische Beschwerden verschiedener Organsysteme auftreten, ohne dass pathologische Befunde erhoben werden können.
Diese Problematik entspricht aber im Grundsatz derjenigen von somatoformen Störungen anderer Ursachenzuschreibung, erklärt Hanns Rüdiger Röttgers (VersMed 70 (2018) 3: 140–151). Die aufwändige deutsche „MCS-Verbundstudie“ aus 2008 lässt es – analog zu internationalen Studienergebnissen – als gesichert erscheinen, dass es weder eine abgrenzbare Symptomatik der MCS noch nachvollziehbare ätiologische Zusammenhänge gibt. Weiter wurden frühere Publikationen bestätigt, die bei MCS-Patienten eine vorwiegend psychische Genese annahmen.
Es gibt daher, so Röttgers, bei der „Multiple Chemical Sensitivity“
Bei der gutachtlichen Beurteilung, ob Berufsunfähigkeit (im Sinne der Berufsunfähigkeitsversicherung) vorliegt, müssen jedoch die vom Kläger angegebenen Beschwerden und Beeinträchtigungen kritisch erfragt und mit Hilfe medizinischer Untersuchungen soweit möglich und vertretbar objektiviert werden, so auch Wolfgang Hausotter und Kai-Jochen Neuhaus in dem aktuellen Buch „Die Begutachtung für die private Berufsunfähigkeitsversicherung“ (Karlsruhe 2019).
Eine solche Objektivierung der Beschwerden durch den Gutachter ist hier aber offensichtlich nicht erfolgt; dieser hat sich lediglich auf die Anamnese verlassen und eine krankheitswerte Reaktion des Klägers auf in der Umwelt vorhandene chemische Stoffe postuliert, ohne dafür irgendwelche Beweise vorzulegen. Die Schlussfolgerung des OLG, es sei nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass der Kläger an einer Erkrankung leide, ist somit durchaus nachvollziehbar und begründet.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 8: 506–507)
Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Ergänzende Begutachtung zur Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Kommt es bei einer (privaten) Erwerbsunfähigkeitsversicherung nach den allgemeinen Vertragsbedingungen darauf an, in welchem Umfang der Versicherungsnehmer trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen noch Tätigkeiten ausüben kann, „die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt üblich sind“, reicht die Einholung eines medizinischen Gutachtens zur Klärung der Voraussetzung eines Rentenanspruchs unter Umständen nicht aus, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe mit Urteil vom 13.12.2018 (AZ: 9 U 152/16).
Vielmehr ist gegebenenfalls ein ergänzendes Gutachten zu den Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt erforderlich, ob es auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tatsächlich Tätigkeiten gibt, die ein spezielles – niedriges – gesundheitliches Anforderungsprofil aufweisen, sodass für den Versicherungsnehmer leidensgerechte berufliche Tätigkeiten trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen noch möglich wären.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 8: 483)
Private Krankenversicherung
Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit
Der Versicherungsnehmer einer privaten Krankenversicherung muss die medizinische Notwendigkeit der Behandlung beweisen, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mit Urteil vom 16.11.2018 (AZ: 20 U 50/18).
Sind nach Angaben des Gerichtssachverständigen zur Beurteilung die schriftlichen Behandlungsunterlagen erforderlich und legt der Versicherungsnehmer diese Unterlagen – trotz gerichtlichen Hinweises – nicht vor, so bleibt er beweisfällig. Der Krankenversicherer kann die Entscheidung über eine
Erstattung der eigereichten Kostenbelege von der Vorlage der Behandlungsunterlagen abhängig machen und in einem solchen Fall das Leistungsbegehren des Versicherungsnehmers als nicht fällig ablehnen.
Für die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung ist ein objektiver Maßstab anzulegen, erklärte das OLG unter Bezug auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 29.3.2017 (AZ: IV ZR 533/15):
Mit dem Begriff „medizinisch notwendige“ Heilbehandlung wird – auch für den Versicherungsnehmer erkennbar – nicht an den Vertrag zwischen ihm und dem behandelnden Arzt und die danach geschuldete medizinische Heilbehandlung angeknüpft. Vielmehr wird zur Bestimmung des Versicherungsfalles ein objektiver, vom Vertrag zwischen Arzt und Patient unabhängiger Maßstab eingeführt.
Diese objektive Anknüpfung bedeutet zugleich, dass es für die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit der Heilbehandlung nicht auf die Auffassung des Versicherungsnehmers und auch nicht allein auf die des behandelnden Arztes ankommen kann. Gegenstand der Beurteilung können vielmehr nur die objektiven medizinischen Befunde und Erkenntnisse im Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung sein. Demgemäß muss es nach den objektiven medizinischen Befunden und Erkenntnissen im Zeitpunkt der Vornahme der ärztlichen Behandlung vertretbar gewesen sein, die Heilbehandlung als notwendig anzusehen, so der BGH.
(Versicherungsrecht 70 (2019) 7: 406–408)
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden