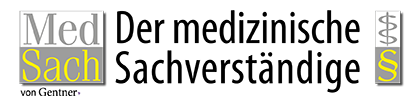Die COVID-19-Pandemie ist seit knapp zwei Jahren das beherrschende Thema, gerade auch in der medizinischen Fachliteratur, auf Kongressen und auf Fortbildungsveranstaltungen.
Hier einige entsprechende Referate zu den verschiedensten Aspekten der Pandemie, die für den Gutachter von Bedeutung sein können – von der Frage der Wirksamkeit von Masken über mögliche Langzeitfolgen der Erkrankung bis hin zu Verschwörungstheorien.
Masken zur Prävention von SARS-CoV-2 auch bei Kindern
Über eine gemeinsame Stellungnahme deutscher Fachgesellschaften aus der Pädiatrie zur Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung einer Infektion mit SARS-CoV-2 berichtete Matthias Kopp, Chefarzt und Direktor der Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern (Schweiz), auf dem 14. Pädiatrie-Update-Seminar am 7. und 8. Mai 2021 (Livestream-Veranstaltung). Hervorzuheben sind folgende Aussagen:
Die Autoren halten in ihrer gemeinsamen Stellungnahme fest, dass Masken auch von Kindern gut akzeptiert werden, wenn vorher eine altersentsprechende Instruktion und Erklärung gegeben wurde, so Kopp.
Aus gutachtlicher Sicht ergibt sich daraus die Konsequenz, dass ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht (etwa in der Schule) auch bei Kindern kritisch hinterfragt werden müssen.
Literatur
Huppertz, H.-I., Schepker, R., Kopp, M. et al. (2021). Verwendung von Masken bei Kindern zur Verhinderung der Infektion mit SARS-CoV-2. Monatsschrift Kinderheilkunde,169, 52–56.
Nach schwerer COVID-Erkrankung oft posttraumatische Belastungsstörung
Ein Viertel der schwer an COVID-19 Erkrankten entwickelt im Durchschnitt drei Monate nach körperlicher Genesung eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Dies ist ein Ergebnis einer der weltweit größten Studien zu den psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie, in der fortlaufend von April 2020 bis März 2021 mehr als 30.000 Menschen untersucht worden waren und die am 16. Juni 2021 auf dem Deutschen Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Online-Veranstaltung) vorgestellt wurde.
Für die Untersuchung haben Forscher der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen Angaben zu Alter und Geschlecht, zu Symptomen für Depression und Angst, zu negativer Stressbelastung und zum Gesundheitszustand erhoben. „Die Studie stellt damit nicht nur national, sondern auch international eine der größten Untersuchungen zu den psychosomatischen Auswirkungen der Pandemie dar“, erklärte Kongresspräsident Volker Köllner.
Zentrales Ergebnis der Studie: In den verschiedenen Phasen der Pandemie war erhöhter psychischer Disstress bei bis zu 65 Prozent, erhöhte generalisierte Angst bei bis zu 45 Prozent, ausgeprägte Corona-Furcht bei 60 Prozent und vermehrte Depressivität bei bis zu 15 Prozent in der Allgemeinbevölkerung nachweisbar.
„Dabei stiegen depressive Symptome zum zweiten Lockdown ab November 2020 sogar noch weiter an“, berichtete Martin Teufel, der als Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der LVR-Kliniken Essen die Studie leitet. Dies könne einem zunehmenden Erschöpfungszustand zugeschrieben werden, fügte er hinzu. „Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Angst- und Depressionssymptome zwar erhöht, allerdings in ihrem Schweregrad überwiegend nicht so ausgeprägt sind, dass die diagnostischen Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt sind.“
Zu den psychisch besonders belasteten Bevölkerungsgruppen zählten Frauen, jüngere Menschen und Personen mit psychischen Vorerkrankungen wie Depression, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen. „Ursachen dafür können der Wegfall von sozialen Kontakten, psychotherapeutischen Behandlungen und Aktivitäten sein, die aus depressiven Episoden heraushelfen“, so Teufel.
Unter den Teilnehmenden der Studie befanden sich auch Personen, die an COVID-19 erkrankten. In dieser Subgruppe fanden die Forscher einen bemerkenswerten Krankheitsverlauf: Bei jedem vierten schwer Erkrankten, der auf einer Intensivstation behandelt werden musste, stellte sich nach körperlicher Genesung mit zeitlicher Verzögerung eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ein. „Bei diesen 25 Prozent kam es im Mittel ab dem 100. Tag nach erfolgreicher stationärer Behandlung zu einem Anstieg von Trauma-Symptomatik“, gab Teufel an.
Das massiv bedrohliche Erlebnis, keine Luft mehr zu bekommen, löse bei diesen Patienten im Nachgang Intrusionen aus. „Die Intrusion äußert sich wie ein Flashback, mit einem plötzlich einschießenden massiven Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, des Erlebens von Kontrollverlust“, beschrieb Teufel die Symptomatik.
Diesen Patienten könne man eine COVID-19-spezifische Traumabehandlung anbieten, etwa in Form einer angeleiteten Schreibtherapie. „Die einschneidende Erfahrung auf der Intensivstation ist ja unstrukturiert als Emotion im Unterbewusstsein abgespeichert“, erklärte Teufel den Wirkmechanismus einer solchen Intervention. „Durch das Narrativ wird sie ins Bewusstsein geholt, aufgearbeitet und neu strukturiert. So kann der Betroffene wieder die Kontrolle über die Affekte erlangen.“
Greifbare körperliche Langzeitfolgen als Folge einer COVID-19-Virus-Infektion sind aus Sicht des Psychosomatikers dagegen selten. So wurden in einer interdisziplinär durchführten Nachsorgestudie der Universitätsmedizin Essen mehr als 300 Personen nach unterschiedlich schwer ausgeprägten COVID-19-Erkrankungen untersucht. Die Patientinnen und Patienten berichteten über unspezifische Symptome wie Schwindel, Kopfweh, Müdigkeit oder Schwächeempfinden. Aber nur bei weniger als zehn Prozent der Betroffenen konnten medizinisch fassbare Befunde erhoben werden.
Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um bisher unentdeckte Erkrankungen, die unabhängig von COVID-19 bestehen. „Die Beschwerden hatten in den seltensten Fällen mit der Virusinfektion zu tun“, so Teufel. „Wir sprechen hier von Bodily Distress, einer somatischen Belastungsstörung.“
Auch bei Patienten, die typischerweise nach einer mittelschweren Corona-Infektion anhaltend unter Luftnot leiden, konnten die Mediziner keine organische Schädigung als Langzeitfolge der Viruserkrankung feststellen; Untersuchungen bestätigten eine ausreichende Lungenfunktion. „Die Betroffenen leiden unter Ängsten, die Erkrankung nicht mehr loszuwerden, und atmen deshalb zu viel. Sie befinden sich in einer Art Hyperventilationszustand, der auf die noch nicht wiedergefundene Sicherheit zurückzuführen ist“, erklärte Teufel die Beschwerdesymptomatik.
Zur Therapie von vermeintlichen Long-COVID-Symptomen empfiehlt er daher als erste Maßnahme die Edukation, um Ängste auf ein rationales Maß zurückzuführen: „Die Patienten müssen wissen: COVID-19 macht in der Mehrzahl der Fälle nicht körperlich dauerkrank. Das Wahrscheinliche nach einer Infektion ist die vollständige somatische Genesung.“
„Long Covid“ – ebenso interessant wie diffus
„Long Covid“ bleibt so interessant wie diffus, berichtete Winfried V. Kern, Leiter der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Freiburg, auf dem 15. Allgemeinmedizin-Update-Seminar am 18. und 19. Juni 2021 (Livestream-Veranstaltung).
Unter „Long Covid“ versteht man eine Sammlung von Beschwerden im Sinne von verzögerter Rekonvaleszenz nach Intensivbehandlung, ungewöhnlichen Erschöpfungssyndromen ohne sicheren organischen Befund, reaktiver Depression sowie ungewöhnlichen neurologischen oder neuropsychiatrischen Beschwerden jenseits von drei Monaten nach der COVID-19-Akuterkrankung. In den USA wird Long Covid inzwischen „PASC“ (postacute sequelae of SARS-CoV-2 infection) genannt; dort investiert man in die Forschung zu PASC mehr 1 Milliarde Dollar.
Es gibt eine Überlappung mit dem bzw. eine schwierige Abgrenzung zum „Chronic Fatigue“ Syndrom/zur so genannten „Myalgischen Encephalopathie“ (CFS/ME), d. h. dem post-viralen oder post-infektiösen Müdigkeitssyndrom, das nach anderen Infektionen (EBV-Infektion, Borreliose, Q-Fieber etc.) immer mal wieder auftritt, ebenfalls unklarer Genese und auch recht heterogen ist, so Kern.
Die Beschwerdekomplexe sind vielfältig, und es stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um eine Besonderheit nach COVID-19 handelt, oder ob solche Beschwerden einer generell verzögerten Rekonvaleszenz nach initial schwerer Erkrankung entsprechen und unspezifisch sind, d. h. auch nach anders verursachten schweren Erkrankungen mit Intensivbehandlungspflicht in ähnlicher Weise auftreten und verlaufen.
Inzwischen mehren sich allerdings Beobachtungen, wonach auch 6 Monate und später nach akuter COVID-19-Erkrankung bei einer gewissen Anzahl von Patienten persistierende Beschwerden vorliegen (und so eher die Bezeichnung „Long Covid“ verdienen), die nicht streng mit der initialen Krankheitsschwere und auch nicht mit dem initialen Beschwerdemuster korrelieren.
Problematisch dabei ist vor allem die offenbar erhöhte Rate von organisch schlecht erklärten
bei ansonsten gesunden Erwachsenen mittleren Alters, die vor ihrer COVID-19-Erkrankung voll im Beruf standen und jetzt längerfristig eingeschränkt oder gar arbeitsunfähig sind.
Die wissenschaftliche Datenlage hierzu ist jedoch sehr limitiert. Langzeitdaten (mit mehr als 6 Monaten Nachverfolgung) gibt es bisher nur wenige, und diese sind oft über Surveys online (via App) erfasst und medizinisch nicht validiert. Sicher ist, dass es persistierende Beschwerden im Sinne von Erschöpfungssyndrom bzw. Belastungsdyspnoe und neurokognitiven Einschränkungen jenseits von 6 Monaten nach Sars-CoV-19-Akutinfektion gibt, fasste Kern den aktuellen Kenntnisstand zusammen. Unklar seien aber v. a. die genaue Inzidenz (mehr als 10 % der an COVID-19 Erkrankten?), die Pathophysiologie und Risikofaktoren sowie auch der Spontanverlauf.
Anmerkung aus gutachtlicher Sicht
Die Begutachtung von Patienten mit „Long Covid“ ist angesichts der aktuell erst sehr begrenzten Kenntnisse zum Krankheitsbild und zum Verlauf oft schwierig. Das ergibt sich allein schon aus der genannten Nähe zum „Chronic Fatigue“ Syndrom, das bekanntlich gutachtlich äußerst problematisch ist. Daher dürfte in vielen Fällen wohl eine psychosomatische Abklärung angezeigt sein.
Verschwörungstheorien zur COVID-19-Pandemie aus psychiatrischer Sicht
Verschwörungstheorien entstehen bevorzugt in anhaltenden Bedrohungssituationen, erklärt der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Hans Förstl bereits Ende letzten Jahres in der „DMW Deutsche Medizinische Wochenschrift“ (2020; 145: 1870–1875). So gibt es etwa die Vermutungen, das AIDS-Virus sei versehentlich in einem Laborexperiment hergestellt worden, oder HIV werde sogar vorsätzlich als Biowaffe zur Elimination der farbigen und armen Bevölkerung eingesetzt.
Entsprechend findet sich eine Flut von Mythen zur COVID-19-Pandemie, v. a. zur angeblichen Herkunft und zum Zweck des Virus. Angeblich beschleunige etwa das 5G-Netz die Virusausbreitung. Könne man 10 Sekunden die Luft anhalten, spreche dies gegen eine akute COVID-19-Infektion, und ein schulmedizinischer Test sei damit verzichtbar.
Bei der Therapie von SARS-CoV-2 steht die Pharma-Industrie im Verdacht, Studien mit heilsamen Natursubstanzen zu hintertreiben. Der Konsum von Knoblauch, aber auch von Kokain (!), oder das Trinken von großen Wassermengen bzw. von Whisky mit Honig werden beispielweise empfohlen. Dagegen soll bei der (inzwischen angelaufenen) Impfung gegen SARS-CoV-2 der Bevölkerung ein von Bill Gates entwickelter Biochip zu Kontrollzwecken implantiert werden.
Solche Erklärungen und Lösungen sind konkreter als die abstrakten Risiken und Chancen im Umgang mit einer Pandemie: Bill Gates ist leichter fassbar als COVID-19, so Förstl.
Die Europäische Kommission hat diese Verschwörungstheorien zur COVID-19-Pandemie als dringenden Anlass aufgefasst, um Diagnosekriterien für
Verschwörungstheorien (wobei der Begriff „Theorie“ irreführend ist, weil er vorgibt, eine wissenschaftlich plausible theoretische Grundlage zu haben) zu definieren:
Der Glaube an Verschwörungstheorien ist mit weniger prosozialem, eher dagegen mit gewaltbereitem Verhalten assoziiert, warnt Förstl. Auf das eigene Gesundheitsverhalten und auch auf die Allgemeinheit bezogen könne die Einstellung toxisch wirken und Vorbehalte sowie Vorurteile verstärken. In der Folge könne der subjektive Gewinn von negativen Konsequenzen für die Allgemeinheit flankiert werden: Schwächende Entsolidarisierung, zeitraubender Antagonismus und demotivierender Kräfteverschleiß.
Als Kernaussagen nennt Förstl:
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden