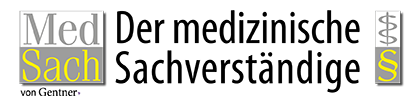Auch wenn Behandlungs- und Aufklärungsfehler in der Psychotherapie in medizinrechtlicher Hinsicht bisher kaum erforscht wurden und einschlägige gerichtlich entschiedene Haftungsfälle selten sind, ist dieses Thema aus gutachtlicher Sicht durchaus von Bedeutung, wie aus einer Übersichtsarbeit von Michaela Hermes und Birgit Lindel in der Fachzeitschrift „Psychotherapeut“ hervorgeht.
Generell ist davon auszugehen, dass auch die Psychotherapie nicht risiko- oder nebenwirkungsärmer ist als Behandlungen in der somatischen Medizin. Unerwünschte Wirkungen können selbst bei einer „lege artis“ durchgeführten Therapie auftreten.
Die Rechtsprechung orientiert sich bei Behandlungsfehlern in der Psychotherapie an den Grundsätzen, die für den Arzthaftungsprozess entwickelt worden sind. Wie bei der ärztlichen Behandlung gilt auch für die psychotherapeutische Behandlung, dass diese entsprechend den allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen hat (§ 630 a Abs. 2 BGB).
Der Begriff des Behandlungsfehlers orientiert sich am Behandlungsstandard. Dieser Standard repräsentiert den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie der therapeutischen Erfahrung, die für das Erreichen des Behandlungsziels erforderlich sind. Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn ein Verstoß gegen die Regeln der therapeutischen Kunst vorliegt, d.h., wenn eine der vertraglichen Pflichten durch den Therapeuten verletzt wird.
Der Richter kann sich auf die sachverständige Expertise eines Gutachters stützen. Außerdem helfen bei der Festlegung der Standardfrage die in einem förmlichen Verfahren einer legitimierten Institution ergangenen verbindlichen Richtlinien, wie die am 21.12.2018 in Kraft getretene Psychotherapie-Richtlinie (GB-A 2018). Das schließt aber die Entwicklung eines darüberhinausgehenden Standards nicht aus.
Weiter ist zu beachten, dass sich aus der Berufserlaubnis des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) für psychologische Psychotherapeuten Einschränkungen bei einer Therapie nach den gängigen Richtlinien ergeben. Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 PsychThG dürfen nur wissenschaftlich anerkannte Verfahren zum Einsatz kommen. Gefordert werden dafür, so das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 30.4.2009 (AZ: C4/08), nachprüfbare Wirksamkeitsbelege für die Feststellung, Heilung oder Linderung seelischer Störungen mit Krankheitswert.
Am Anfang der Psychotherapie steht die Abklärung somatischer Erkrankungen, denn jeder psychischen Störung kann eine organische Erkrankung zugrunde liegen. Diese somatische Abklärung hat vor Beginn der Richtlinien-Therapie zu erfolgen (§ 1 Abs. 3 Satz 2 PsychThG). Sie ist Voraussetzung für die Durchführung der psychotherapeutischen Behandlung und muss spätestens nach den probatorischen Sitzungen erfolgen. Versäumt der Psychotherapeut die somatische Abklärung oder wird sie nicht durch einen Facharzt durchgeführt, kann dies haftungsrechtliche Konsequenzen haben.
Auch nach der somatischen Abklärung kann es aber sein, dass die seelische Erkrankung nicht klar und eindeutig bestimmbar ist. Die Rechtsprechung hat hierzu grundsätzlich anerkannt, dass Irrtümer bei der Diagnose vorkommen können (so zuletzt der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 26.1.2016; AZ: VI ZR 146/14). Eine objektiv unzutreffende Diagnose darf daher nicht vorschnell als Behandlungsfehler bewertet werden. Haftungsrechtlich erheblich wird es erst dann, wenn das diagnostisch erzielte Ergebnis nicht mehr vertretbar ist, also die Befunde vollkommen falsch gedeutet werden.
Ein wichtiger, von der Rechtsprechung behandelter Themenkomplex ist schließlich die Suizidprävention bei schweren psychischen Erkrankungen: Ärzte und auch Psychotherapeuten müssen den Patienten vor einer Selbstschädigung bewahren. Insbesondere dann, wenn der Patient in eine psychiatrische oder psychotherapeutische Klinik eingewiesen wird, sind dort konkrete Maßnahmen zu seinem Schutz erforderlich.
Eine akute Suizidgefahr ergibt sich allerdings nicht schon daraus, dass der Patient rein vorsorglich auf der geschlossenen Station aufgenommen wurde oder bei ihm eine depressive Störung diagnostiziert ist. Genauso wenig reicht es, wenn er lediglich latent Suizidgedanken äußert oder wenn vorangegangene Suizidversuche bekannt sind.
Erhebt der Behandler die erforderlichen Befunde allerdings nicht und verkennt deswegen eine Suizidabsicht, liegt hierin ein Behandlungsfehler. Ausschlaggebend sind die „richtige“, methodisch fundierte Befunderhebung und Diagnoseerstellung; nur dieses (methodische) Vorgehen ist letztlich rechtlich überprüfbar. Das Suizidrisiko ist immer aus einer sog. Ex-ante-Perspektive zu sehen, also aus der Überlegung, wie sich die Gefahr zum Zeitpunkt der Behandlung dargestellt hat.
(Hermes M, Lindel B: Haftungsfragen in der Psychotherapie. Psychotherapeut 65 [2020]: 32–35)
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden