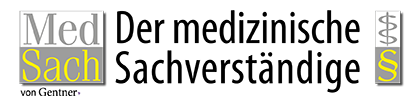Zudem haben die inversen Prothesen deutlich längere Standzeiten als bei deren Einführung vor über 20 Jahren prognostiziert. So hat die inverse Prothese auch bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen die konventionelle Totalendoprothese der Schulter weitgehend abgelöst.
Die Veränderung der Krafteinleitung in das Schultergelenk über den Musculus deltoideus anstelle der Rotatorenmanschette bei der inversen Prothese führt allerdings zu einer erheblichen Zugbelastungen auf das Akromion und die Spina scapulae. Insbesondere bei Osteoporose, welche bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in der Regel stärker ausgeprägt ist und häufiger auftritt als in der Normalbevölkerung, ist die Gefahr für Spontan- und Ermüdungsfrakturen des Akromions und der Spina scapulae erhöht. Dieses besondere Risiko muss in die Operationsaufklärung mit einfließen, so Gaulke.
G.-M. Ostendorf, Wiesbaden