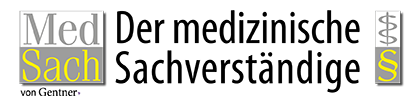Wir danken den Autoren für die Auseinandersetzung mit diesem hoch relevanten und komplexen Themenbereich. Aus unserer Begutachtungspraxis der psychoreaktiven Traumafolgestörungen in verschiedenen Rechtsgebieten teilen wir die Erfahrung, dass die Diagnose der PTBS zu häufig und oft fehlerhaft gestellt wird.
Unsere Kritik richtet sich gegen Inhalte des Artikels, die dem aktuellen internationalen wissenschaftlichen Stand widersprechen. Im Folgenden möchten wir diese stichpunktartig darstellen: Die zum Schluss dargestellten Leitgedanken für die medizinischen Sachverständigen widersprechen dem aktuellen internationalen Konsens und dürfen daher in der Begutachtung keinesfalls als Bezug auf eine vermeintliche Allgemeingültigkeit übernommen werden. Die erste Aussage, dass die PTBS in der Regel innerhalb der ersten 6 Monate mit und ohne Therapie ausheile und chronische Verläufe sehr selten seien, entspricht weder den Aussagen des DSM-5 und der ICD-11 noch der S3 Leitlinie (AWMF).
Nach einer Studie von Kessler (1995) leiden 30 bis 40% der Patienten noch nach einem Jahr unter Symptomen der PTBS. Auch das DSM-5 gibt an, dass die PTBS-Symptomatik bei der Hälfte der Patientinnen und Patienten zwar innerhalb von drei Monaten nach der akuten Belastungsreaktion vollständig remittieren, aber bei vielen Betroffenen Symptome länger als 3 Monate bestehen bleiben. Dabei kann es zur wechselnden Zu- und Abnahme der Symptome kommen sowie zu deren Wiederaufleben durch situative Belastungen oder neue traumatische Erlebnisse. Bei älteren Menschen können nachlassende Gesundheit, sich verschlechternde kognitive Fähigkeiten oder soziale Isolation PTBS-Symptome verschärfen. Auch in der S3 Leitlinie wird auf eine hohe Chronifizierungsrate hingewiesen.
Übereinstimmend zeigt die internationale Forschung, dass nur eine zeitnahe und spezifische Behandlung traumareaktiver Störungen in 80 – 90 % der Fälle zu einer Remission führen kann (van Etten et al. 1998, Bradley 2005). Wohingegen ohne leitliniengerechte Behandlung es im Verlauf häufig zu einer Ausweitung der Symptome und stärkeren Funktionsbeeinträchtigungen kommt (NICE Guidelines 2005, Australian Guidelines 2007, Stein et al. 2009, Flatten et al. 2013, Foa et al. 2009).
Im zweiten Leitgedanken werden die bedrohlichen Lebensereignisse zu eng gefasst. Die ICD-11 nimmt differenziert Stellung zur Unterscheidung PTBS und KPTBS (komplexe PTSB). Bei den von den Autoren dargestellten traumatischen Ereignissen, bei welchen ausschließlich eine KPTBS zu diagnostizieren sei, wird die nach ICD-11 am häufigsten mit der KPTBS assoziierte innerfamiliäre Gewalt in der Kindheit gänzlich ignoriert und fälschlicherweise geschlussfolgert, die diagnostischen Kriterien der KPTBS könnten in Deutschland nur „extrem selten“ erfüllt sein.
Die prozentualen Angaben der Autoren aus der eigenen Begutachtungspraxis sind zu vage, um daraus eine valide statistische Folgerung zu treffen. Auch die tabellarischen Darstellungen werden missverständlich, inkonsistent und fehlerhaft dargestellt. Zum Beispiel werden verschiedene Diagnosemanuale ohne Kennzeichnung in einer Tabelle vermischt. Als Differenzialdiagnosen der PTBS wird u.a. die Verbitterungsstörung aufgeführt, diese ist aber gar keine gesicherte wissenschaftliche Diagnose entsprechend der aktuellen Diagnosesysteme.
Die Begutachtung der reaktiven Traumafolgestörungen ist, wie im Artikel dargestellt, ausgesprochen anspruchsvoll. Sie erfordert sowohl ein hohes Maß an praktischer Erfahrung mit traumatisierten Menschen, deren Symptomatik, Symptompräsentation und Reaktivität als auch die Expertise in der Begutachtung dieser Personengruppe. Weder eine ausschließliche klinische Kompetenz in der Behandlung traumatisierter Menschen noch eine ausschließliche gutachterliche Kompetenz werden den komplexen Anforderungen an die psychotraumatologische Begutachtung gerecht.
Psychotherapeuten, denen die Verpflichtung zur Neutralität in der Rolle als Gutachter nicht geläufig ist, laufen Gefahr, parteilich zu sein. Gutachter, denen die Psychotraumatologie nicht bekannt ist, laufen Gefahr, viele Aspekte fehlzuinterpretieren: „PTSD ist ein Störungsbild mit multiplen Symptomen aus unterschiedlichen Bereichen von offensichtlichen und nicht-offensichtlichen Symptomen, wovon mehrere – insbesondere Flashbacks und Amnesie – nur unzureichend konzeptualisiert sind und in den Klassifikationssystemen durch vage Definitionen angegeben werden. Selbst erfahrene Kliniker … verstehen diese Zusammenhänge nicht ausreichend. Hieraus resultieren teilweise recht eigentümliche Interpretationen.“ (Foa et al., 2009).
Literatur
1 Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB (1995), Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity sample in Archives of General Psychiatry 52: 1048 – 1060
2 Van Etten M, Taylor S (1998), Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis, Clinical Psychology and Psychotherapy 5
3 Bradley R A (2005), Multidimensional metaanalysis of psychotherapy for PTSD, American Journal of Psychiatry,16(2), 2005.S. 214 – 227
4 NICE Guidelines National Institut of Clinical Excellence (2005)
5 Australian Guidelines Australian Centre for Posttraumatic Mental Health (2007)
6 Kapstadt Konsensuskonferenz in Stein DJ, Cloitre M, Nemmerofff CB, Nutt DJ, Seedat S, Shalev AY, Wittchen HU, Zohar J (2009), Cape Town consensus on posttaumatic stress disorder, CNS Spectrum 14 (1 Suppl1): 52 – 8
7 S3 Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung in Flatten G, Gast U, Hoffmann A, Knaevelsrud Ch, Lampe A, Liebermann P, Maercker A, Reddemann L, Wöller W (2013), Posttraumatische Belastungsstörung Leitlinien und Quellentexte, Schattauer Verlag
8 Foa EB, Keane TM, Friedman MJ, Cohen JA (2009), 2. Auflage, Effective treatments for PTSD. Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. S. 29-30.
Anschrift für die Verfasserinnen:
Dipl. Psych. Julia Klöfer
Psychologische Psychotherapeutin
Psychotherapeutische Praxis
Humboldtstr. 20A
68169 Mannheim
kontakt@praxiskloefer.de
Jutta Fischer-Knust
Fachärztin für Neurologie, Psychotherapie, TP, Siegen
Elena Kotschunz
Dipl.-Psych., Psychotherapeutin für Erwachsene, VT, Osnabrück
Klaus Hantel-Pletzer
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für psychotherapeutische Medizin, Schwerte
Karin Hirsch
Dipl.-Psych., Psychotherapeutin für Erwachsene, Kinder und Jugendlich, VT, München
Qualitätszirkel für die Begutachtung psychoreaktiver Traumafolgestörungen
Antwort der Verfasserin:
Wir freuen uns über die Zustimmung zu unseren Ausführungen, dass die PTBS zu oft diagnostiziert wird. Die Autoren des Leserbriefs scheinen aber die Hauptaussage unseres Artikels, den wir bewusst mit „Aus der Praxis für die Praxis“ überschrieben haben, nicht wirklich verstanden zu haben.
Es wird behauptet, Inhalte des Artikels würden dem aktuellen internationalen wissenschaftlichem Stand widersprechen, und unsere Leitgedanken für medizinische Sachverständige dürften keinesfalls als Bezug auf eine vermeintliche Allgemeingültigkeit übernommen werden. Als erstes werden zwei Studien aus dem Jahr 2009 zitiert sowie eine Australische Guideline und die S3 Leitlinie zur PTBS, denen zufolge eine hohe Chronifizierungsrate der PTBS belegt sei. Nur durch eine zeitnahe und spezifische Behandlung traumareaktiver Störungen könne in 80-90 % der Fälle eine Remission erreicht werden, andernfalls komme es im Verlauf zur Ausweitung der Symptome und zu stärkeren Funktionsbeeinträchtigungen.
Augsburger und Maercker (2020) schreiben in der ganz aktuellen Übersichtsarbeit zu PTBS und KPTBS, dass individuelle Verläufe kaum vorherzusagen seien und keinem eindeutigen Muster folgen würden. Eine Meta-Analyse von 42 Studien habe gezeigt, dass ungefähr die Hälfte der Personen mit einer PTBS Symptomatik nach mehr als drei Jahren ohne spezifische Behandlung keine Symptome mehr aufweise.
Klöfer et al. gehen nicht ein auf das wichtige, in unserem Artikel genannte Thema der Resilienz (Harms, 2017), sondern setzen den Fokus allein auf die Chronifizierung und die unbedingte Behandlungsnotwendigkeit. Aber längst nicht jeder Traumatisierte, der die Schwelle unserer Praxen übertritt, braucht eine Langzeittherapie. Aus über 30jähriger Erfahrung als Psychiaterin und Ärztin für Psychotherapeutische Medizin sei der Autorin ein Fallbeispiel erlaubt: Eine schwer traumatisierte junge Frau, die als Beifahrerin den Unfalltod ihrer Schwester miterlebte, empfand zu Beginn der Behandlung große Erleichterung nach der Aussage „Das, was Sie jetzt empfinden und erleben, ist völlig normal, es würde nahezu jedem anderen in ähnlicher Lage so gehen“. Danach genügten sehr vertrauensvolle Psychotherapiestunden im einstelligen Bereich, um ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Sie ging mit dem Bewusstsein, diese schwere Krise mit Unterstützung von Familie und Freunden selbst meistern zu können – selbstverständlich mit dem Angebot, sich bei Bedarf nochmals vorzustellen, was aber nicht eintrat.
Wer tatsächlich eine längere Therapie braucht, der benötigt vor allem zuerst die richtige Diagnose, und die lautet eben nicht nach jedem schweren Trauma PTBS, sondern es gibt eine Reihe von wichtigen und richtigen Differenzialdiagnosen, wie sie im Artikel ausführlich dargelegt wurden. Aus dem Gesagten dürfte auf der Meta-Ebene deutlich geworden sein, dass entsprechend dem eigenen beruflichen Blickwinkel Traumatologen andere Schwerpunkte sehen als Psychiater, deren Sichtweise eine viel Breitere ist.
Weiter wird im Leserbrief moniert, die bedrohlichen Lebensereignisse in Bezug auf die KPTBS seien von uns zu eng gefasst worden, wobei hier nicht richtig zitiert wurde. Unser Artikel bezieht sich auf Gutachten aus dem Zeitraum 2014 bis 2020, entsprechend mussten die hierfür geltenden Diagnosemanuale DSM-IV-TR bzw. DSM-5 sowie ICD-10 zugrunde gelegt werden. Das ICD-11 ist veröffentlicht, darf aber erst ab dem 1.1.2022 herangezogen werden. Insofern ist unsere Aussage zutreffend, dass die diagnostischen Kriterien wiederkehrender extremer Traumatisierungen wie anhaltende Todesbedrohung von Geiseln, KZ-Haft, Haft in den früheren Staatsgefängnissen der DDR und Folter in Deutschland extrem selten erfüllt sein können, dennoch waren wir immer wieder in den Unterlagen mit dieser Diagnose konfrontiert.
Das ICD-11 ergänzt – wie Klöfer et al. zurecht anmerken – für die KPTBS diese wiederkehrenden Traumata um die die Themen häusliche Gewalt sowie sexueller Missbrauch und Misshandlungen in der Kindheit, wobei alle früheren Kriterien erhalten bleiben, also die Forderung nach langanhaltender Dauer und nach der Unmöglichkeit, dem Ereignis zu entkommen. Ein entsprechender Hinweis ist möglich als Ergänzung unter Punkt zwei unserer Leitgedanken, allerdings kann aus unserer Sicht die Auslegung der Kriterien zum Wohle der Betroffenen gar nicht eng genug sein, damit es nicht wiederum zu einer schädlichen inflationären Ausweitung der Diagnose kommt. Im Hinblick auf junge Traumatisierte ist es zunächst Aufgabe der Kinder- und Jugendpsychiater eine Diagnose zu stellen, nicht der Traumatherapeuten. Der Hintergrund dieser Ergänzungen ist der sicher positive Gedanke, den von gravierenden Symptomen Betroffenen das Stigma der Persönlichkeitsstörung zu ersparen und ihnen mit der Diagnose KPTBS eine geeignete Behandlung zukommen zu lassen (Augsburger et al., 2020).
Weiter wird kritisiert, dass die prozentualen Angaben aus unserer Praxis zu vage seien, um daraus eine valide statistische Folgerung zu treffen. Dies haben wir auch nicht behauptet. Wir haben lediglich belegt, dass in unserer Praxis die Diagnose PTBS in einem sehr hohen Ausmaß in den Akten vorkam, ohne dass die Diagnosekriterien erfüllt waren.
Die tabellarischen Darstellungen sind nicht, wie behauptet, missverständlich, inkonsistent oder fehlerhaft, sondern durch Literaturstellen genau belegt. Die Differenzialdiagnose posttraumatische Verbitterungsstörung, codiert mit ICD 43.2 im Sinne einer Anpassungsstörung, ist eine deskriptive, phänomenologisch geprägte Diagnose, die sowohl für die Begutachtung als auch für die Behandlung pragmatische Wege aufzeigt. Es ging in unserem Artikel nie darum, diese Diagnose als wissenschaftlich gesicherte Diagnose zu bezeichnen, sie ist aber in den Untersuchungen von Linden et al. (2004) sehr gut begründet.
Am Ende ihrer Ausführungen wagen sich Klöfer et al. auf ein sehr diffiziles Gebiet. Sie wollen offenbar ihre Sicht deutlich machen, dass „die ausgesprochen anspruchsvolle Begutachtung reaktiver Traumafolgestörungen ein hohes Maß an praktischer Erfahrung mit traumatisierten Menschen erfordert, und dass selbst erfahrene Kliniker das Störungsbild der PTBS in seinen Zusammenhängen oft nicht ausreichend verstehen, woraus recht eigentümliche Interpretationen resultieren würden, Gutachter würden Gefahr laufen, viele Aspekte fehl zu interpretieren.“
Wir wollten mit unserem Artikel aufzeigen, dass die falsche Anwendung der Diagnosekriterien den Betroffenen iatrogen schadet. Wir wollten zum Schutz der Patienten mit einer PTBS und zum Schutz derjenigen, die wegen der falschen Zuordnung zur Diagnose PTBS nicht der richtigen Behandlung zugeführt werden, den Blick deutlich erweitern auf die möglichen Differenzialdiagnosen.
Klöfer et al. hingegen verengen den Blick nochmals extrem und sind offenbar der Meinung, nur in psychologischer und/oder psychiatrischer Traumotologie Ausgebildete seien überhaupt in der Lage, die richtige Diagnose PTBS zu stellen und eine erfolgreiche Therapie durchzuführen. Welche Motivation hinter dieser Annahme steht, erschließt sich für die Autoren nicht vollständig.
Aus unserer Sicht wären hier fachübergreifende Weiterbildungsangebote wünschenswert, ja notwendig, damit sich Psychiater, Psychotherapeuten und Traumatherapeuten sowie Ärzte anderer Fachrichtungen zu diesem wichtigen Thema fundiert austauschen und voneinander lernen können.
Wie eingangs erwähnt haben Klöfer et al. unsere Hauptbotschaft des Artikels nicht wirklich verstanden, weshalb das Zitat von Dörner (2004) abschließend nochmals wiederholt werden soll: „Denn in einer Zeit, in der wir alle mehr als früher die Opfer so sehr lieben, gehört zu unserer ärztlichen Professionalität auch das Wissen, dass wir solche Patienten mit zu viel Liebe, zu vielen Rechtsansprüchen und zu viel Mitleid auch auf ihre Opferrolle fixieren und somit lebenslänglich schädigen und chronifizieren können.“
In dieser Erwiderung zum Leserbrief wurden einzelne Aspekte unseres Artikels nochmals verdeutlicht, insofern wird auf die dort angegebene Literatur verwiesen.
Literatur:
1 Augsburger M, Maercker A (2020), Posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS und KPTBS: Ein Leitfaden für die Diagnostik und Behandlung. Kohlhammer
2 Dörner K (2004), Posttraumatische Belastungsstörungen – Neues Fass im Gesundheitsmarkt, Trauma Berufskrankh 6 (Suppl 3), 327 – S328
3 Harms, L (2017), Trauma und Resilienz, Junfermann Verlag, 91 - 117
4 Linden M, Schippan B, Baumann K, Spielberg R (2004), Die Posttraumatische Verbitterungsstörung (PTED) – Abgrenzung einer spezifischen Form der Anpassungsstörungen. Der Nervenarzt 1, 51 – 57
Anschrift der Verfasserin/der Verfasser:
Dr. med. Dipl. Psych. Claudia Spieß-Kiefer
Nervenärztin, Ärztin für Psychotherapeutische Medizin
Dr. med. Hartmut Kiefer Nervenarzt
Dr. med. Thomas Berbig Nervenarzt
Praxis für Begutachtungen
Rosenheimer Str. 52
81699 München