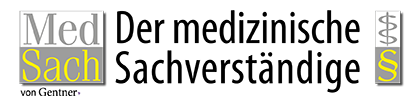Leitsatz:
1. Liegen bereits Gutachten oder Auskünfte vor, so steht es im Ermessen des Verwaltungsgerichts, ob es zusätzliche Auskünfte oder Sachverständigengutachten einholt.
2. Zur Einholung eines weiteren Gutachtens ist das Gerichts nur verpflichtet, wenn das vorhandene Gutachten nicht (hinreichend) geeignet ist, dem Gericht die für die richterliche Überzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen zu vermitteln. Das ist anzunehmen, wenn das vorliegende Gutachten auch für den Nichtsachkundigen erkennbare (grobe) Mängel aufweist.
Aus den Gründen:
Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. … Die vom Kläger allein geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO liegen nicht vor bzw. sind nicht hinreichend dargelegt.
Das Verwaltungsgericht hat angenommen, dass der Bescheid der Beklagten über die Festsetzung des Kostenbeitrags vom 17. Juni 2015 in der Gestalt des Änderungsbescheids vom 27. März 2019, der seine Rechtsgrundlage in §§ 91 Abs. 1 Nr. 6, 92 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 SGB VIII finde, rechtmäßig sei. Dem Sohn des Klägers sei mit der Bewilligung von Eingliederungshilfe (W.-Privatschule) in der Zeit vom 17. August 2014 bis zum 30. November 2015 eine kostenbeitragspflichtige Leistung gewährt worden. Die erforderliche Aufklärung über die Kostenbeitragspflicht sei erfolgt. Der monatliche Kostenbeitrag sei mit 3.084,00 Euro … zutreffend … berechnet worden. Die gewährte Jugendhilfeleistung sei nicht rechtswidrig. Die Beschulung in einer Privatschule mit Internatsunterbringung sei im Zeitraum ab dem Schuljahr 2014/15 mangels bedarfsdeckender Hilfe im öffentlichen Schulwesen sachgerecht und notwendig gewesen. Auch wenn im Sommer 2013 eine Beschulung in der Gesamtschule bei optimaler medikamentöser Einstellung und Unterstützung durch einen Integrationshelfer noch als ausreichend angesehen worden sei, habe sich später gezeigt, dass der Sohn des Klägers in einer Regelschule nicht beschulbar sei. Die nach § 35 a Abs. 1 a SGB VIII vorgeschriebene Stellungnahme eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie liege seitens des sachverständigen Zeugen Dr. med. U. vom 30. Juli 2013 vor. Neben den diagnostizierten psychischen Störungen - Asperger-Syndrom (F 84.5) und ADHS (F 90.0) - habe dieser eine seelische Behinderung festgestellt. …
Diese näher begründeten Annahmen werden mit dem Zulassungsvorbringen nicht durchgreifend in Zweifel gezogen. Der Kläger macht geltend …
Mit diesem Vorbringen dringt der Kläger nicht durch. Insbesondere bestehen keine ernstlichen Zweifel hinsichtlich der erstinstanzlichen Annahme, beim Sohn des Klägers habe im maßgeblichen Zeitraum 2014/15 keine geistige Behinderung vorgelegen, die der Rechtmäßigkeit der bewilligten Eingliederungsmaßnahme nach § 35 a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII wegen des gemäß § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII geltenden Vorrangs von Leistungen den Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und damit einer Kostenbeitragspflicht des Klägers entgegenstehen könnte.
Für die hier relevante Entscheidung, ob neben der seelischen Behinderung auch eine geistige Behinderung vorliegt, kommt es, was auch der Kläger nicht in Zweifel zieht, maßgeblich darauf an, ob der IQ des Sohnes des Klägers unter 70 liegt. Denn eine (leichte) geistige Behinderung liegt erst dann vor, wenn der anhand standardisierter Intelligenztests festgestellte IQ weniger als 70 beträgt. Diese aus der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (International Classification of Diseases: ICD-10) folgende Abgrenzung zur bloßen „Lernbehinderung“ wird auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt (Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 29. September 2014 - 12 E 774/14 -, juris Rn. 31 ff., m. w. N.).
Nur im Ausgangspunkt zu folgen ist dem Einwand des Klägers, die jüngste Messung des IQ seines Sohnes am 17. Juni 2013 habe lediglich einen Gesamtwert von 69 ergeben. Die erstinstanzliche Einschätzung, es liege keine geistige Behinderung vor, wird damit indessen nicht schlüssig in Zweifel gezogen. Denn das Verwaltungsgericht hat dazu nachvollziehbar auf der Grundlage der Stellungnahmen des sachverständigen Zeugen vom 30. Jul 2013 und 4. Dezember 2018 und der ergänzenden Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass der Sohn des Klägers bei der betreffenden Testung unter seinen Möglichkeiten geblieben sei und zur Einschätzung des Intelligenzniveaus möglichst viele Testungen herangezogen werden müssten. Dabei sei zu beachten, dass bei der beim Sohn des Klägers vorliegenden, mit Konzentrationsschwierigkeiten einhergehenden Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung die Medikation Einfluss auf die Leistungsfähigkeit gehabt habe. Bei Durchführung unter Ritalin, was bei IQ-Tests bei ADHS-Patienten durchaus üblich sei, sei der Sohn des Klägers kognitiv leistungsfähiger gewesen, habe sein „wahres“ Leistungspotential abrufen können und einen Gesamt-IQ von 85 (April 2011) erreicht. Gerade bei ADHS-Patienten dürfe nicht lediglich der letzte Test herangezogen werden, sondern müssten Ergebnisse über einen längeren Zeitraum gewonnen werden.
Soweit der Kläger rügt, die Ermittlung aus mehreren Messungen sei fraglich, wird dies mangels näherer Substantiierung nicht nachvollziehbar. Ob in Fällen, in denen wie hier mehrere Werte vorliegen, eine Mittelung vorzunehmen ist, oder ob auf den höchsten erreichten Wert bzw. einen Wert unter Medikation abzustellen ist, bedarf keiner weiteren Vertiefung. Denn das Ergebnis liegt, wie bereits vom Verwaltungsgericht festgestellt, jedenfalls oberhalb des maßgeblichen Wertes von 70.
Dieses Ergebnis wird ferner nicht mit dem Einwand in Frage gestellt, es sei verwunderlich, dass das in der gutachterlichen Stellungnahme vom 30. Juli 2013 relevante Ergebnis von 87 (HAWIK von 2009) an keiner Stelle angeführt werde. Auch wenn dieser Wert in der Stellungnahme tatsächlich nicht ausdrücklich benannt wird, führt dies schon deswegen nicht weiter, weil Dr. med. U. die verschiedenen berücksichtigten Werte und Testergebnisse in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 4. Dezember 2018 im Einzelnen benennt und den durchgeführten Tests unter zeitlicher Einordnung zuordnet. Danach resultiert der höchste erreichte Gesamt-IQ aus einem Testverfahren im Jahr 2007 (HAWIWA-3). Dass dieses Ergebnis tatsächlich so erzielt wurde, stellt auch der Kläger nicht in Frage, der dieses Ergebnis neben zahlreichen weiteren selbst in seine mit Schriftsatz vom 15. Januar 2018 überreichte Aufstellung aufgenommen hat. Dass der Wert 87 damit (wohl) nicht aus dem HAWIK stammt, mag zutreffen. Unter welchem Gesichtspunkt dies hier relevant sein soll, macht das Zulassungsvorbringen indessen nicht erkennbar.
Auch soweit der Kläger weiter bemängelt, das im HAWIWA-3 Testverfahren im Jahr 2007 gewonnene Ergebnis habe (bei Anfertigung der gutachterlichen Stellungnahme) schon sechs Jahre zurückgelegen, zieht er damit die erstinstanzliche Feststellung, es sei keine geistige Behinderung anzunehmen, nicht durchgreifend in Zweifel. Denn er lässt dabei unberücksichtigt, dass Dr. med. U. verschiedene weitere Testergebnisse aus den Jahren 2006 bis 2013 herangezogen und dabei insbesondere auch die Entwicklung der Testergebnisse über den Zeitraum sowie die jeweiligen Rahmenbedingungen (insbesondere auch Medikation), wogegen der Kläger im Übrigen auch nichts Substantiiertes vorträgt, in seine Betrachtung mit einbezogen hat. Vor diesem Hintergrund trifft ferner auch die sachverständige Einschätzung, das singuläre Testergebnis von einem IQ 69 im Jahr 2013 nicht als (allein) ausschlaggebend anzusehen, auf keine durchgreifenden Bedenken.
Dass der Sohn des Klägers ab dem Jahr 2016 auf eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung (GE)“ gegangen ist, weil er aufgrund seiner kognitiven Leistungen auf der I.Privatschule nicht mehr beschulbar gewesen sei, begründet ebenfalls keine Zweifel an der erstinstanzlichen Einschätzung, es liege keine geistige Behinderung vor. Dem insoweit nicht näher substantiierten Vorbringen lässt sich nicht entnehmen, ob der Entscheidung über den Schulwechsel irgendwelche (wissenschaftlich fundierten) Testungen oder sonstigen (sachverständigen) Einschätzungen zugrunde lagen. Hinzu kommt, worauf auch das Verwaltungsgericht schon hingewiesen hat, dass der Sohn des Klägers (wohl) seit einigen Jahren keine Medikamente mehr genommen hatte, was die intellektuelle Leistungsfähigkeit aus Gutachtersicht einschränken kann. Damit setzt sich das Zulassungsvorbringen nicht näher auseinander. Ungeachtet dessen betrifft diese mit dem weiteren Schulwechsel verbundene Entwicklung nicht den hier streitbefangenen Leistungs- bzw. Kostenbeitragszeitraum.
Das Verwaltungsgericht konnte seine Entscheidung über das Vorliegen einer geistigen Behinderung auch rechtsfehlerfrei (allein) auf die sachverständige Stellungnahme (einschließlich Ergänzungen) des Dr. med. U. stützen und musste kein weiteres (medizinisches) Gutachten einholen. Insoweit liegt auch kein Verfahrensfehler im Sinne des Zulassungsgrundes nach § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO vor, auf den der Kläger sich im Übrigen auch allenfalls sinngemäß beruft. Ob eine weitere Sachverhaltsermittlung erforderlich oder der entscheidungserhebliche Sachverhalt - etwa durch ein bereits vorliegendes fachärztliches Gutachten - schon hinreichend aufgeklärt ist, fällt - ebenso wie die Würdigung der Erkenntnismittel als solche - unter die richterliche Überzeugungsbildung nach § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die Überzeugungsbildung kann daher nicht allein deshalb in Frage stehen, weil etwa der Rechtsmittelführer bei der Würdigung derselben Umstände möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommt.
Im Hinblick auf die weitere Aufklärung durch Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens gilt Folgendes: Aufgabe eines Sachverständigen ist es, dem Gericht besondere Erfahrungssätze und Kenntnisse des betroffenen Fachgebiets zu vermitteln und/oder aufgrund von besonderen Erfahrungssätzen oder Fachkenntnissen Schlussfolgerungen aus einem feststehenden Sachverhalt zu ziehen. Liegen bereits Gutachten oder Auskünfte vor, so steht es nach § 98 VwGO, §§ 404 Abs. 1, 412 Abs. 1 ZPO im Ermessen des Gerichts, ob es zusätzliche Auskünfte oder Sachverständigengutachten einholt. Das Gericht kann sich dabei ohne Verstoß gegen seine Aufklärungspflicht (sogar) auf Gutachten oder gutachterliche Stellungnahmen stützen, die - wie hier - von der zuständigen Behörde im Verwaltungsverfahren eingeholt worden sind. Das Gericht ist nur verpflichtet, ein weiteres Gutachten einzuholen, wenn sich ihm auf der Grundlage seiner materiell- rechtlichen Rechtsauffassung eine weitere Sachaufklärung aufdrängen muss. Das ist nur dann der Fall, wenn das vorhandene Gutachten nicht (hinreichend) geeignet ist, dem Gericht die für die richterliche Überzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen zu vermitteln. Das wiederum ist anzunehmen, wenn das vorliegende Gutachten auch für den Nichtsachkundigen erkennbare (grobe) Mängel aufweist, etwa nicht auf dem allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft beruht, von unzutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht, unlösbare inhaltliche Widersprüche enthält oder Anlass zu Zweifeln an der Sachkunde oder Unparteilichkeit des Gutachters gibt. Die Verpflichtung zur Einholung eines weiteren Gutachtens folgt hingegen nicht schon daraus, dass ein Beteiligter das vorliegende Gutachten als Erkenntnisquelle für unzureichend hält (Ständige Rechtsprechung des BVerwG, vgl. etwa Urteil vom 6. Februar 1985 - 8 C 15.84 -, juris Rn. 16, 23, m. w. N., sowie Beschlüsse vom 26. Februar 2008 - 2 B 122.07 -, juris Rn. 29 f., vom 3. Februar 2010 - 2 B 73.09 -, juris Rn. 9, und vom 20. März 2014 - 2 B 59.12 -, juris Rn. 10; vgl. auch Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 11. Dezember 2019 - 1 A 1815/17 -, juris Rn. 13 f., m. w. N.).
Für ein danach anzunehmendes Erfordernis zur Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens legt der Kläger keine hinreichenden Anhaltspunkte dar. Soweit der Kläger rügt, Dr. med. U. sei (zunächst) im Auftrag der Beklagten tätig geworden und erst im Laufe des gerichtlichen Verfahrens vom Verwaltungsgericht benannt worden, begründet dies nach den dargestellten Grundsätzen für sich gesehen weder eine fehlerhafte Sachverhaltsermittlung oder -würdigung noch sonst ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung.
Aber auch im Hinblick auf die hier maßgebliche materielle Frage, ob eine geistige Behinderung vorliegt bzw. ob vom Vorliegen eines IQ von über 70 ausgegangen werden kann, werden mit dem Zulassungsvorbringen im Hinblick auf die gutachterlichen Stellungnahmen keine durchgreifenden Mängel aufgezeigt. Den - bereits vorstehend aufgegriffenen - Einwänden des Klägers gegen die Einschätzungen des Dr. med. U. bzw. gegen die darauf beruhenden Annahmen des Verwaltungsgerichts lassen weder grobe Fehler oder unlösbare Widersprüche hinsichtlich der Stellungnahmen noch Zweifel an der Sachkunde oder Unparteilichkeit des sachverständigen Zeugen erkennen.
Der vom Kläger angeführte beschränkte Auftrag an Dr. med. U., der nicht dahingehend gewesen sei, über alle Erkrankungen ein umfassendes Gutachten zu erstellen, verlangt keine andere Einschätzung. Denn es ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, in welcher Weise das Vorliegen weiterer Erkrankungen erheblich für die Aussagekraft der den IQ betreffenden Testergebnisse gewesen sein könnten.
Ist nach alldem nicht vom Vorliegen einer geistigen Behinderung auszugehen mit der Folge, dass einer Kostenbeitragspflicht des Klägers auch nicht die Vorrangigkeit einer Leistungspflicht nach SGB XII entgegensteht, bedarf es hier keiner weiteren Klärung, ob die Erkrankungen des Sohnes des Klägers insbesondere differenzialdiagnostisch zutreffend und abschließend mit den gutachterlichen Stellungnahmen des Dr. med. U. geklärt worden sind. Denn es ist nicht hinreichend substantiiert dargelegt, dass eine weitere oder auch exaktere Diagnostik, welcher Art die Autismus-Erkrankung des Sohnes des Klägers ist, in der vorliegenden Fallgestaltung von Einfluss auf das (Nicht-)Vorliegen einer geistigen Behinderung ist. Der Kläger rügt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen die vom sachverständigen Zeugen verwendeten Diagnoseverfahren für die differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen dem Asperger-Syndrom und anderen Formen des Autismus.
Ungeachtet dessen legt der Kläger aber auch keine hinreichenden Anhaltspunkte für (grobe) Mängel der sachverständigen Stellungnahmen dar. Solche ergeben sich zunächst nicht daraus, dass sich Dr. med. U. bei der Diagnostik bzw. den Tests, die auf Fragebögen beruhen, ausschließlich auf die Aussage der Kindesmutter, nicht aber des Vaters gestützt hat. Auch sonst ist nicht ersichtlich, dass es in wissenschaftlicher Hinsicht zwingend der Einschätzung beider Elternteile bedarf. Der Kläger hat ferner nichts Näheres dazu vorgetragen, dass die Mutter möglicherweise unzutreffende Angaben gemacht haben könnte. Hinzu kommt, dass der Kläger im Zusammenhang mit der Diagnostik (wohl) tatsächlich nicht zur Verfügung stand bzw. nicht zur Mitwirkung bereit war.
Mit dem Einwand, die Diagnostik mittels MBAS-Fragebogens sei überholt gewesen und andere Diagnoseverfahren (in der Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störungen) wie das ADOS oder das ADI-R seien bereits seit dem Jahr 2009 implementiert gewesen, legt der Kläger ebenfalls keine ernstlichen Zweifel dar. Denn auch wenn es offenbar bereits neuere Testmethoden gab und deswegen die Differentialdiagnostik der Autismus-Störung möglicherweise tatsächlich nicht mehr dem anerkannten Stand der Wissenschaft entsprochen haben sollte, ist dies hier jedenfalls im Zusammenhang mit der Frage des Vorliegens einer geistigen Behinderung - wie dargestellt - im Ergebnis nicht von ausschlaggebender Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund ist es für das Entscheidungsergebnis auch letztlich nicht erheblich, ob und in welchem Umfang beim Sohn des Klägers verschiedene Kriterien – insbesondere das Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung und fehlende oder geringe kognitive Einschränkungen - vorliegen, die für das von Dr. med. U. diagnostizierte Asperger-Syndrom typisch sind.
Ohne Erfolg rügt der Kläger schließlich, für die Entscheidung über die Internatsunterbringung habe es gemäß § 35 a Abs. 1 a SGB VIII einer erneuten gutachterlichen Stellungnahme bedurft, da die Stellungnahme des Dr. med. U. vom 30. Juli 2013 im Zusammenhang mit der zunächst erfolgten Installation eines Integrationshelfers für den Besuch an einer Regelschule erstellt worden sei. Der Kläger weist indessen bereits selbst (zutreffend) darauf hin, dass es sich (lediglich) um eine Änderung der Hilfemaßnahme gehandelt hat. Aufgabe des Arztes ist in diesem Zusammenhang (lediglich) die Beurteilung, ob und inwieweit die seelische Gesundheit von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Die Entscheidung darüber, welche Hilfemaßnahme zu gewähren ist, liegt indessen beim Jugendhilfeträger, der dazu den medizinischen Sachverstand heranzieht, so dass es beim Wechsel der Hilfeart nicht zwingend einer neuen sachverständigen Stellungnahme bedarf. Aber selbst für den Fall, dass eine Abweichung von der in § 35 a Abs. 1a SGB VIII vorgesehenen Verfahrensweise anzunehmen und infolgedessen ein Verfahrensfehler zu bejahen sein sollte, wäre dieser jedenfalls nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 5 SGB X analog geheilt (Vgl. dazu Kepert/Dexheimer, in: Kunkel/Kepert/Pattar, SGB VIII, 8. Aufl. 2022, § 35 a Rn. 17).
Denn Dr. med. U. hat sich im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich mit den hier für die konkrete Hilfemaßnahme maßgeblichen Fragen befasst.
Die Kostenentscheidung …
Redaktionell überarbeitete Fassung
eingereicht von P. Becker, Kassel