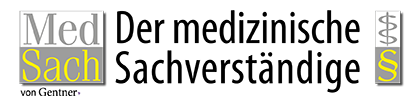Professorin Dr. phil. Irmgard Vogt hat das Schwerpunktthema koordiniert und selbst einen Übersichtsartikel verfasst. „In der deutschen Sozial- und Suchtforschung spielt die sexuelle Identität bislang leider kaum eine Rolle“, sagt die Psychologin, die bis 2009 an der Frankfurt University of Applied Sciences gelehrt hat. Daher greift sie hauptsächlich auf Studien aus dem anglo-amerikanischen Raum zurück. Hier wurden und werden deutlich häufiger auch die sexuelle Identität, sexuelle Präferenzen und das Sexualverhalten abgefragt und in Bezug zu psychische Störungen und der Entwicklung von Suchterkrankungen sowie entsprechender Behandlungsangebote gesetzt.
Eine Reihe von Studien zeigt, dass psychische Belastungen bei sexuellen Minderheiten – pauschal – betrachtet häufiger auftreten als bei Heterosexuellen. Sie leiden vermehrt unter Substanzkonsumstörungen. Dazu zählen ein exzessiver beziehungsweise abhängiger Konsum von Alkohol, Tabak und anderen psychoaktiven Stoffen. Aber auch Depressionen, Ängsten und Persönlichkeitsstörungen treten vergleichsweise oft auf. „Im Vergleich mit heterosexuellen und homosexuellen Männern und Frauen leiden bisexuelle Frauen besonders häufig unter diesen psychischen Störungen“, resümiert Vogt. Sie litten bis zu viermal so häufig unter psychischen Problemen wie heterosexuelle Frauen. Auch über Suizidversuche berichten bisexuelle Frauen häufiger als Homosexuelle beider Geschlechter.
Das Wissen um die besonderen Bedürfnisse und Belastungen sexueller Minderheiten sollte auch in Deutschland deutlich mehr berücksichtigt werden. Das gelte für Forschungen zum Gesundheitsverhalten und die Psychotherapieforschung gleichermaßen. Darüber hinaus sollten in der Suchthilfe und allgemein in der Psychotherapie die spezifischen Belastungen und Bedürfnisse der sexuellen Minderheiten eine größere Rolle spielen als bisher, so Vogt. Während in den USA knapp jede fünfte Anlaufstelle für Suchtkranke auch spezielle Angebote für sexuelle Minoritäten bereithalte, sei dies hierzulande nur sehr selten der Fall. Wichtig seien unter anderem affirmative Therapiestrategien, die das Selbstwertgefühl stärken, Schuldgefühle verringern und zu einem offenen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität ermutigen.
Dass es für den Therapieerfolg entscheidend sein kann, auf sexuelle Besonderheiten Rücksicht zu nehmen, wird bei der Suchttherapie von Trans-Männern und -Frauen besonders deutlich. Wie Forscher des Interdisziplinären Transgender Versorgungscentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in ihrem Beitrag darlegen, kann die Hormonbehandlung, die die Geschlechtsangleichung oft begleitet, die Dynamik einer Suchterkrankung sowohl abschwächen, als auch verstärken. Es sei daher wichtig, die Patienten auf mögliche Begleitumstände vorzubereiten und bereits vor Beginn der Hormontherapie effektive Strategien zum Umgang mit Suchtdruck und Substanzkonsum zu entwickeln. Zudem hat die Hormontherapie immer auch einen Effekt auf die Stimmung: So können Östrogene und Anti-Androgene (feminisierende Hormone) und Androgene (maskulinisierende Hormone) einen positiven oder negativen Einfluss auf bereits vorhandene affektive Störungen und somit Auswirkungen auf die Psychotherapie haben.
I. Vogt:
Sexuelle Identität, der Konsum von Alkohol und anderen Drogen, gesundheitliche Probleme und Behandlungsansätze: Ein unsystematischer Forschungsüberblick
Suchttherapie 2018; 19 (4); S. 168–175
L. I. Kürbitz et al.:
Substanzgebrauch im Kontext von Trans*: Diagnostik und Implikationen
Suchttherapie 2018; 19 (4); S. 176–185
Pressemittelung Thieme
Eine Reihe von Studien zeigt, dass psychische Belastungen bei sexuellen Minderheiten – pauschal – betrachtet häufiger auftreten als bei Heterosexuellen. Sie leiden vermehrt unter Substanzkonsumstörungen. Dazu zählen ein exzessiver beziehungsweise abhängiger Konsum von Alkohol, Tabak und anderen psychoaktiven Stoffen. Aber auch Depressionen, Ängsten und Persönlichkeitsstörungen treten vergleichsweise oft auf. „Im Vergleich mit heterosexuellen und homosexuellen Männern und Frauen leiden bisexuelle Frauen besonders häufig unter diesen psychischen Störungen“, resümiert Vogt. Sie litten bis zu viermal so häufig unter psychischen Problemen wie heterosexuelle Frauen. Auch über Suizidversuche berichten bisexuelle Frauen häufiger als Homosexuelle beider Geschlechter.
Das Wissen um die besonderen Bedürfnisse und Belastungen sexueller Minderheiten sollte auch in Deutschland deutlich mehr berücksichtigt werden. Das gelte für Forschungen zum Gesundheitsverhalten und die Psychotherapieforschung gleichermaßen. Darüber hinaus sollten in der Suchthilfe und allgemein in der Psychotherapie die spezifischen Belastungen und Bedürfnisse der sexuellen Minderheiten eine größere Rolle spielen als bisher, so Vogt. Während in den USA knapp jede fünfte Anlaufstelle für Suchtkranke auch spezielle Angebote für sexuelle Minoritäten bereithalte, sei dies hierzulande nur sehr selten der Fall. Wichtig seien unter anderem affirmative Therapiestrategien, die das Selbstwertgefühl stärken, Schuldgefühle verringern und zu einem offenen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität ermutigen.
Dass es für den Therapieerfolg entscheidend sein kann, auf sexuelle Besonderheiten Rücksicht zu nehmen, wird bei der Suchttherapie von Trans-Männern und -Frauen besonders deutlich. Wie Forscher des Interdisziplinären Transgender Versorgungscentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in ihrem Beitrag darlegen, kann die Hormonbehandlung, die die Geschlechtsangleichung oft begleitet, die Dynamik einer Suchterkrankung sowohl abschwächen, als auch verstärken. Es sei daher wichtig, die Patienten auf mögliche Begleitumstände vorzubereiten und bereits vor Beginn der Hormontherapie effektive Strategien zum Umgang mit Suchtdruck und Substanzkonsum zu entwickeln. Zudem hat die Hormontherapie immer auch einen Effekt auf die Stimmung: So können Östrogene und Anti-Androgene (feminisierende Hormone) und Androgene (maskulinisierende Hormone) einen positiven oder negativen Einfluss auf bereits vorhandene affektive Störungen und somit Auswirkungen auf die Psychotherapie haben.
I. Vogt:
Sexuelle Identität, der Konsum von Alkohol und anderen Drogen, gesundheitliche Probleme und Behandlungsansätze: Ein unsystematischer Forschungsüberblick
Suchttherapie 2018; 19 (4); S. 168–175
L. I. Kürbitz et al.:
Substanzgebrauch im Kontext von Trans*: Diagnostik und Implikationen
Suchttherapie 2018; 19 (4); S. 176–185
Pressemittelung Thieme