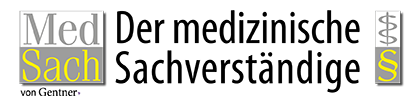Die Begutachtung einer Borreliose und ihrer Folgen kann den Gutachter schnell in schwieriges Gelände führen. Eine vielgesichtige Symptomatik, die Möglichkeit auch einer spontanen Ausheilung, das Überspringen von klinischen Stadien und nicht immer eindeutig zu interpretierende Laborbefunde machen die Zuordnung von Beschwerden und Symptomen vielfach nicht einfach, zumal auch bei dieser Erkrankung mit nicht immer hilfreicher Einflussnahme von Interessengruppen auf die Begutachtung zu rechnen ist. Der erste Beitrag dieses Heftes von Hausotter versucht, hierzu dem Gutachter einen Leitfaden für eine zutreffende Beurteilung auch in der Abgrenzung zu somatoformen Störungen zu geben.
Ein weiteres ständig wiederkehrendes Streitthema behandelt Carstens im folgenden Beitrag, nämlich die Frage der Wegefähigkeit unter Berücksichtigung der einwirkenden einzelnen körperlichen Faktoren, insbesondere chronischer Schmerzen. Bei fehlender linearer Korrelation zwischen dem Ausmaß von Gesundheitsstörungen, die Einfluss auf das Gehvermögen haben, und der Gehfähigkeit für eine bestimmte Strecke muss hier vom Gutachter für jeden Einzelfall diese Gehfähigkeit herausgearbeitet werden, also für die Wegefähigkeit im Rechtsbereich der Rentenversicherung erläutert werden, warum viermal täglich noch über 500 Meter in 20 Minuten zurückgelegt werden können (oder nicht), und ob als Voraussetzung für die Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr (Merkzeichen „G“ im SGB IX) noch zwei Kilometer in 30 Minuten zurückgelegt werden können.
Den Abgrenzungsproblemen von traumatischen Knorpelschäden zu anlagebedingten Arthrosen widmet sich der Beitrag von Hempfling. Befunden der Kernspintomografie kommen hier in letzter Zeit zunehmende Bedeutung zu. Zu diesem Thema kann auch ergänzend auf den Beitrag von Schröter und Bohndorf „Bildgebende Verfahren in der Begutachtung – was ist zu beachten?“ in Heft 3/2014 dieser Zeitschrift verwiesen werden.
Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) ist das einzige Gesetz des sozialen Entschädigungsrechts mit einer noch nennenswerten und steigenden Anzahl von Anträgen, wobei wie ausgeführt von Brettel und Bartsch im letzten Beitrag dieses Heftes umfassende statistische Daten etwa zur Quote der Anerkennungen, zur Zahl der Opfer von Straftaten, zu Art und Ausmaß der Schädigungen und auch zu den Kosten des Gesetzes bis heute nicht existieren. Hier bestehe noch Raum für Forschung. Von den Autoren wird bemängelt, dass die Vorstellungen im Gesetz hinsichtlich von Opferfolgen von Straftaten nicht mehr zeitgemäß seien und einer Weiterentwicklung bedürften, die eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsbedürftigen nach sich ziehen würde. Beispielsweise sei hier an die Betroffenen von Wohnungseinbrüchen zu denken. Teilweise war die im Beitrag vorgetragene Kritik – wie etwa an „restriktiven Anerkennungsquoten“ – auch schon Thema in dieser Zeitschrift. Es kann hierzu einmal auf die in Heft 5/1990 des MedSach wiedergegebenen vier Vorträge, gehalten auf der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in jenem Jahr veranstalteten Versorgungsmedizinischen Fortbildungstagung über Begutachtungsfragen verwiesen werden. Weiter war die Problematik auch schon Thema des „Heidelberger Gesprächs“ im Jahre 2011, bezogen speziell auf Fragen Kindesmissbrauch und Opferentschädigung. Die Beiträge hierzu von Dettmeyer – aus medizinischer Sicht – und Doering-Striening – aus juristischer Sicht – sind in Heft 2/2012 des MedSach nachzulesen.
Zuletzt hingewiesen sei noch auf die Neufassung der Tafel 30, mit der jeweils zum Ende eines Jahres mit Hinweis auf die aktuelle Gutachtenliteratur und aktuelle Adressen im Internet zu gutachtlich wichtigen Informationen dem Gutachter eine Hilfe für seine Arbeit gegeben werden soll.
E. Losch, Frankfurt/Main