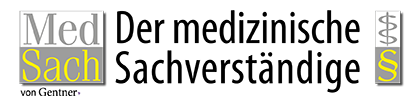Auch Krankheiten haben ihre Geschichte, und jede Zeit hat „ihre“ Krankheiten, vermutlich eben die, die Ausdruck ihrer Grundhaltung sind. Wirklich neu ist allerdings meist nur die Bezeichnung. Auch die Symptomatik, mit der sich uns heute das „Burnout-Syndrom“ präsentiert, ist schon lange bekannt und beschrieben, so etwa 1880 im Buch von George M. Beard „Die Nervenschwäche (Neurasthenie). Ihre Symptome, Folgezustände und Behandlung“. Zwischendurch evozierte diese Symptomatik u.a. auch als „Managerkrankheit“ und verschwand genauso wieder – bis zum Auftreten als „Burnout“. Der Psychosomatiker Arthur Jores (1967) hat das Auftreten derartiger Krankheitszustände, die hinsichtlich Ätiologie und Pathogenese unbekannt sind und deren Therapie immer symptomatisch bleibt, als Zeichen dafür gewertet, „dass in dieser Gesellschaft eine Lebensform entwickelt worden ist, die dem Menschen nicht völlig adäquat ist“, ein Symptom „für ein falsch gelebtes Leben“.
Die Neurasthenie hat im ICD-10 heute eine Diagnoseziffer, das Burnout-Syndrom mangels fehlender Diagnosekriterien und wegen bestehender Abtrennungsprobleme zu anderen Erkrankungen aber nicht. Es wird unter „Restkategorie Z 93, Probleme verbunden mit der Lebensführung“ verschlüsselt – eine vermutlich völlig zutreffende Kategorisierung (s.o. Jores). Im Vorfeld der Bearbeitung der Neuauflage des DSM-5 gab es umfangreichen Druck von Interessengruppen hinsichtlich einer Aufnahme des Burnout-Syndroms in das Manual, Eingang hat es jedoch auf Grund berechtigter Einwände hierin nicht gefunden. Wenn jedoch nach mehreren Untersuchungen je nach Berufsgruppe Burnout-Raten von bis zu 30 % unterstellt werden müssen, ist wie auch immer die Frage nach dem Umgang mit diesem Syndrom auch in der Begutachtungsmedizin evident.
Der letzte in diesem Heft wiedergegebene Themenblock des „Heidelberger Gesprächs“ vom Oktober 2013 hatte eben diese gutachtliche Sicht auf das „Burnout-Syndrom“ zum Inhalt, wie immer aus verschiedenen Blickwinkeln. Der einleitende Beitrag von Friederich und Henningsen erläutert die medizinischen Grundlagen und die systematische Einordnung des Syndroms, während die nachfolgen Ausführungen von Legner den Umgang mit diesem Syndrom im Bereich der Deutschen Rentenversicherung, von Rohdich und Pinne für den Bereich des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, von Richarzt-Salzburger, Lederer und Köhler für das Beamtenrecht und von Drechsel-Schlundt und Portunè für die gesetzliche Unfallversicherung darstellen, letzter Beitrag besonders unter dem Aspekt der Prävention im Arbeitsleben. Zur Ergänzung besonders zur Behandlung in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung kann weiterhin auf den früheren Beitrag von Hausotter zu diesem Thema in Heft 5/2012 dieser Zeitschrift verwiesen werden.
Gutachtliche Fragen der Rentenversicherung behandelt Philipp im Beitrag Schweregradeinschätzungen bei Depressionen und Angsterkrankungen. Ausführungen von Berg zur Begutachtung bei Fragen der Grundsicherung für Arbeitssuchende und zum Mehrbedarf für eine kostenaufwändige Ernährung schließen die Reihe der Originalarbeiten in diesem Heft ab.
Hingewiesen sei schließlich noch auf einen Leserbrief von Gaidzik zum Beitrag von Kaya zum neuen Patientenrechtegesetz (Der Behandlungsvertrag, §§ 630a-h BGB) in Heft 2/2014 dieser Zeitschrift.
E. Losch, Frankfurt/Main